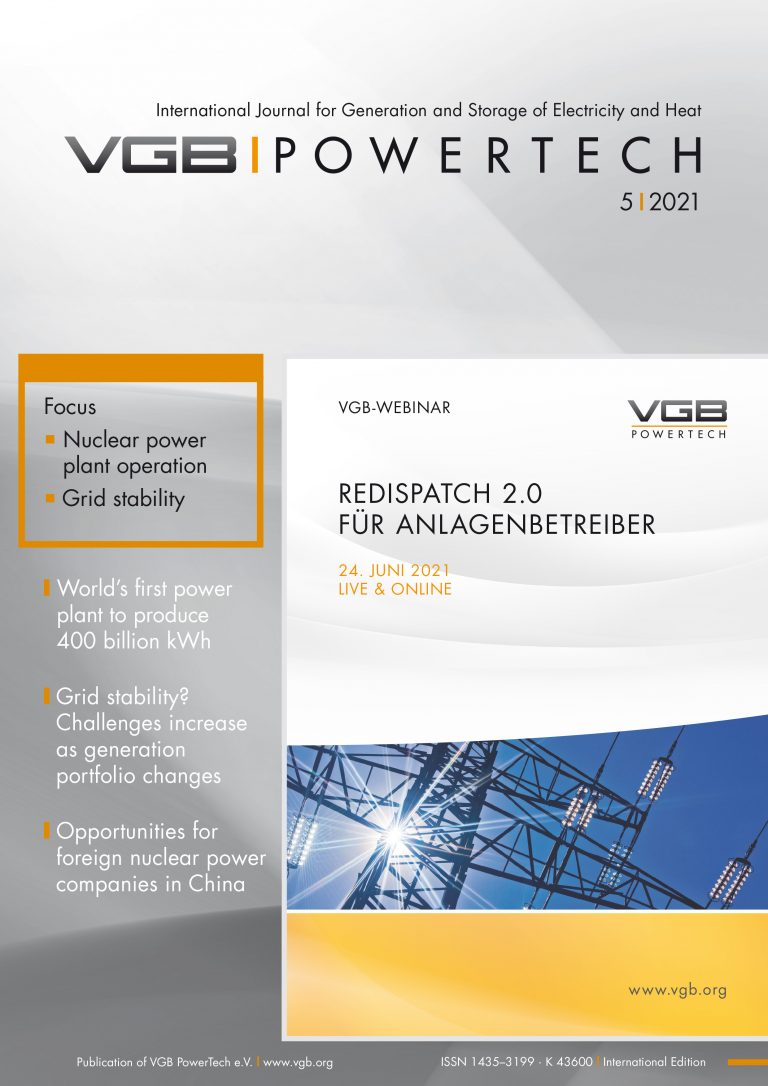Kernenergie: Das Jahr 2020
Christopher Weßelmann
Einsatz und Ausbau der Kernenergie sind weiterhin einerseits geprägt von einer geografisch deutlich verschobenen Tendenz ihres Zubaus von ihren Ursprungsregionen, Nordamerika und Europa, hin zu den neuen Akteuren in Asien. Andererseits ist festzustellen, dass sowohl China als auch Russland in den weltweiten Kernenergiemarkt als Exporteure von Gesamtkonzepten einsteigen. Dabei sind die Zielländer dieser Aktivitäten nicht allein Staaten mit laufenden Kernkraftwerken, sondern auch die sogenannten Newcomer. Hier besteht die besondere Herausforderung auch darin, dass neben dem eigentlichen Bau von ersten Kernkraftwerken zudem eine geeignete Infrastruktur aufgebaut werden muss. Dies betrifft den technischen Sektor für den zukünftigen Betrieb der Kernkraftwerke, soweit er Vor-Ort erforderlich ist, als auch das regulatorische Umfeld. Unterstützt werden diese nationalen Aktivitäten international vor allem von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die eine ganze Reihe von Unterstützungs- und Entwicklungs-Programmen für diese Themen initiiert hat.
Weltweit erster Kraftwerksblock mit 400 Milliarden Kilowattstunden
Matthias Domnick, Sebastian von Gehlen, Stephan Kunze, Gerald Schäufele, Dietmar Schütze und Ralf Südfeld
Mit der ersten Netzsynchronisation am 05.09.1984 um 14:11 Uhr beginnt die Erfolgsgeschichte des Gemeinschaftskernkraftwerks Grohnde (KWG): Seit seiner Inbetriebnahme war der Druckwasserreaktor insgesamt achtmal Weltmeister in der Jahresstromerzeugung. Und auch heute noch hat das Kernkraftwerk Grohnde einen Anteil von gut zwölf Prozent an der Stromerzeugung in Niedersachsen und trägt somit dazu bei, die Stromversorgung Deutschlands stabil zu halten. Zu dieser beeindruckenden Bilanz gesellte sich kürzlich ein weiterer Rekord: Am 7. Februar 2021 produzierte das KWG als erster Kraftwerksblock weltweit die 400-milliardste Kilowattstunde. Es existiert weltweit kein einziger Kernkraftwerksblock, der mehr Strom erzeugt hat. Mit dieser Strommenge hätte man über ein dreiviertel Jahr ganz Deutschland mit Strom versorgen können (bezogen auf die Daten des Jahres 2019 in Höhe von 512 TWh).
Quo vadis, Netzstabilität?
Herausforderungen wachsen mit der Veränderung des Erzeugungsportfolios
Kai Kosowski und Frank Diercks
Das Stromerzeugungsportfolio im deutschen Hochspannungs-Übertragungs- und Verteilnetz verändert sich seit 2011 ständig. Nach mehreren Jahrzehnten mit einer relativ konstanten Segmentierung in Grund-, Mittel- und Spitzenlast und einem entsprechend darauf ausgelegten Kraftwerkspark haben sich in den letzten 10 Jahren deutliche Veränderungen ergeben. Als wichtiges Ergebnis der sogenannten Energiewende, die 2011 mit der Abschaltung der ersten deutschen Kernkraftwerke (KKW) nach dem Reaktorunfall in Fukushima begann, werden die letzten KKWs bis Ende 2022 endgültig vom Netz gehen. Das Kohleausstiegsgesetz vom 8. August 2020, eine weitreichende Änderung mit Bedeutung für die Energiewirtschaft in Deutschland, verlangt die Abschaltung aller Kohlekraftwerke bis spätestens 2038. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird es im deutschen Kraftwerkspark keine großen, induktiven Kraftwerke zur Erzeugung von Grundlast mehr geben.
Entwicklung von sicherheitstechnischen Nachwärmeabfuhrpfaden für Druckwasserreaktoren deutscher Technologie (Leicht- und Schwerwasser)
Franz Stuhlmüller und Rafael Macián-Juan
Die auf Entwicklungen in Deutschland basierenden Druckwasserreaktor-KKW für angereicherten Brennstoff (PLWR) einerseits und für Natururan (PHWR) andererseits sind in ihrer Basiskonzeption weitgehend identisch. Ein markanter Unterschied besteht jedoch im Umfang der Reaktorhauptsysteme. Während diese beim PLWR nur aus dem Reaktorkühl- und dessen Druckhalte- und Abblasesystem bestehen, kommt beim PHWR noch das Moderatorsystem hinzu, das im Leistungsbetrieb der Anlage den Moderator (Schwerwasser) permanent zu kühlen hat. Dieses verfahrenstechnische System wird in Zweitfunktion als innerstes Glied der sicherheitstechnisch wichtigen Nachkühlkette zur Wärmeabfuhr nach dem Abschalten des Reaktors verwendet. Während man beim PLWR – auch für die neuesten Anlagen – sowohl zum Abkühlen nach planmäßiger Abschaltung als auch zur Beherrschung der überwiegenden Zahl anzunehmender Störfalle in der ersten Zeit nach Schadenseintritt auf die weitere Bespeisung der Dampferzeuger angewiesen ist, wurde für den PHWR die Möglichkeit geschaffen, die Reaktorkühlung von Anfang an allein über die Nachkühlkette durchzuführen.
Anhand der Statusprojekte beider Kraftwerkslinien dokumentieren sich nicht nur deren Einheitengrößen-Wachstum, sondern auch die Entwicklungs-Schritte ihrer Nachkühlketten-Technologie, die hier aufgezeigt wird.
Analyse zum Bedarf von Technologie für die Kernenergienutzung in China: Chancen für ausländische Nuklearunternehmen
Hong Xu, Tao Tang und Baorui Zhang
Weltweit hat China die größte Anzahl von Kernkraftwerksblöcken (KKW) in Bau oder Planung. Dies verspricht vielfältige Geschäftsmöglichkeiten für den Nuklearmarkt. Gleichzeitig verfügt China über eine umfassende Nuklearindustrie mit hunderten von zusammenarbeitenden Unternehmen bzw. Organisationen. Der riesige Markt der Kernkraft ist aber attraktiv für ausländische Kernkraftunternehmen. China hat ein gutes Umfeld für internationale Kooperationen. Das Problem liegt in einer Klärung des möglichen Bedarfs in den traditionellen Teilbereichen der Kernenergietechnologie und der verschiedenen Tochtergesellschaften für eine Zusammenarbeit. Aufgrund der Herausforderung für eine Bedarfsanalyse und der Ungewissheit der Bewertung, stellt dieser Artikel eine statistische Methode vor, die auf der Bewertung der Experten der China Nuclear Energy Association (CNEA) und Berichten zum Nuklearsektor basiert. Die Schlussfolgerung dieses Artikels kann als Referenz für die internationale Zusammenarbeit in der Kernenergienutzung verwendet werden.
Fehlerreduzierung bei der Radioaktivitätsberechnung für ein stillgelegtes Kernkraftwerk unter Berücksichtigung der detaillierten anlagenspezifischen Betriebsgeschichte
Young Jae Maeng und Chan Hyeong Kim
Eine genaue Abschätzung des Radioaktivitätsinventars in einem stillgelegten Kernkraftwerk (KKW) ist wichtig, um eine vernünftige Rückbaustrategie festzulegen und die Kosten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle bei der Stilllegung zu ermitteln. Die Berechnung des Aktivitätsinventars erfordert mehrere Eingabeparameter, einschließlich der Zielnuklide, der Bestrahlungsgeschichte und des Neutronenflusses. Häufig berücksichtigen bestehende Radioaktivitätsberechnungen für ein stillgelegtes KKW nicht die detaillierte anlagenspezifische Betriebsgeschichte, einschließlich der zyklusspezifischen Neutronenflussdaten, was zu erheblichen Fehlern führen kann. In dieser Studie wird der Effekt der Verwendung einer detaillierten Historie auf die Aktivitätsberechnung vorgestellt. Berechnet werden die Aktivitäten von Proben in sechs im KKW Kori 1 eingesetzten Targets, wobei zwei Ansätze verwendetet werden: (1) unter Berücksichtigung und (2) ohne Berücksichtigung der detaillierten Historie. Die mit diesen beiden Ansätzen berechneten Aktivitäten wurden mit gemessenen Werten verglichen, um die Verbesserung der Genauigkeit zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass die Genauigkeit deutlich deutlichverbessert wird, wenn die detaillierte Bestrahlungshistorie berücksichtigt wird. Der durchschnittliche Fehler der berechneten Aktivitäten wurde von 12 %, 41 % und 30 % auf 5 %, 9 % bzw. 9 % für 63Cu,60Co, 54Fe(n,p)54Mn und 58Ni(n,p)58Co Reaktionen reduziert. Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die Berücksichtigung der detaillierten anlagenspezifischen Betriebsgeschichte bei der Aktivitätsberechnung für ein stillgelegtes Kernkraftwerk notwendig ist.
„Forum Energie“: Europa auf dem Weg in die Katastrophe
Nach dem Lockdown ein Blackout?
Herbert Saurugg
Das europäische Stromversorgungssystem befindet sich in einem fundamentalen Umbruch, wo vor allem gilt: „Viele Köche verderben den Brei“. Denn es fehlt an einer systemischen Gesamtkoordination und Vorgangsweise. Jedes Mitgliedsland macht seine eigene Energiewende in unterschiedliche Richtungen und es ist kaum eine koordinierte Vorgangsweise erkennbar. Zudem werden fundamentale physikalische und technische Rahmenbedingungen ignoriert und durch Wunschvorstellungen ersetzt, was absehbar ein eine Katastrophe führen muss. Denn das Stromversorgungssystem gehorcht rein physikalischen Gesetzen. Noch haben wir die Möglichkeit, diesen fatalen Pfad zu verlassen.
Betriebserfahrungen mit Kernkraftwerken 2020
VGB PowerTech
Innerhalb des VGB-Fachausschusses „Kernkraftwerksbetrieb“ wird seit mehr als 30 Jahren ein intensiver Austausch von Betriebserfahrungen mit Kernkraftwerken gepflegt. An diesem Erfahrungsaustausch sind Kernkraftwerksbetreiber aus mehreren europäischen Ländern beteiligt. Über im Jahr 2019 erzielte Betriebsergebnisse sowie sicherheitsrelevante Ereignisse, wichtige Reparaturmaßnahmen und besondere Umrüstmaßnahmen wird berichtet.
Editorial
Kernenergie: Das Jahr 2020
Einsatz und Ausbau der Kernenergie sind weiterhin einerseits geprägt von einer geografisch deutlich verschobenen Tendenz ihres Zubaus von ihren Ursprungsregionen, Nordamerika und Europa, hin zu den neuen Akteuren in Asien. Andererseits ist festzustellen, dass sowohl China als auch Russland in den weltweiten Kernenergiemarkt als Exporteure von Gesamtkonzepten einsteigen. Dabei sind die Zielländer dieser Aktivitäten nicht allein Staaten mit laufenden Kernkraftwerken, sondern auch die sogenannten Newcomer. Hier besteht die besondere Herausforderung auch darin, dass neben dem eigentlichen Bau von ersten Kernkraftwerken zudem eine geeignete Infrastruktur aufgebaut werden muss. Dies betrifft den technischen Sektor für den zukünftigen Betrieb der Kernkraftwerke, soweit er Vor-Ort erforderlich ist, als auch das regulatorische Umfeld. Unterstützt werden diese nationalen Aktivitäten international vor allem von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), die eine ganze Reihe von Unterstützungs- und Entwicklungs-Programmen für diese Themen initiiert hat.
Sicherlich eindrucksvoll ist in diesem Zusammenhang die Inbetriebnahme des ersten Kernkraftwerksblocks in der Arabischen Welt zu erwähnen, dem Block 1 am Standort Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Stromversorgung des Landes basiert quasi ausschließlich auf Erdgas, versorgt aus heimischen Quellen, mit aktuell rund 30.000 MW. Da die Golfstaaten mit langfristigem Blick auf die Zukunft auch eine Diversifizierung ihrer Wirtschaft und (Energie)-Infrastruktur planen und umsetzen, erfolgte im Jahr 2008 eine offizielle Prüfung der Option Kernenergie. Ein Jahr später, im Dezember 2009, wurde die Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) gegründet und im gleichen Monat gewann ein Konsortium unter Führung der südkoreanischen Korea Elektric Power Corporation (KEPCO) die Ausschreibung für den Bau von vier Kernkraftwerksblöcken vom Typ APR-1400 mit insgesamt 5.600 MW Leistung. Die offizielle Grundsteinlegung erfolgte dann am 14. März 2011. Am 31. Juli 2020 erreichte der Block 1 des Kernkraftwerks Barakah Erstkritikalität und wurde am 19. August mit dem Netz synchronisiert. Die kommerzielle Inbetriebnahme erfolgte jüngst, am 1. April 2021. Die Inbetriebnahme der weiteren drei Blöcke ist mit Abstand von jeweils rund einem Jahr geplant. Die Vereinigten Arabischen Emirate und die Betreibergesellschaft ENEC legen insgesamt viel wert auf viel Know-how und sehr gut ausgebildetes Personal im eigenen Land.
Russland hat mit der Inbetriebnahme des ersten nach Weißrussland exportierten Kernkraftwerks – geplant sind aktuell zwei WWER V-491 Blöcke mit jeweils 1.194 MW Leistung – demonstriert, wie eine mit maßgeblicher Unterstützung des Lieferanten umgesetzte Infrastruktur den Betrieb von Kernkraftwerken fördert und dass auch in einem Newcomer-Umfeld ein Kernkraftwerk zügig errichtet werden kann. Baustart für den Block Belarusian-1 war im November 2013, Erstkritikalität wurde am 11 Oktober 2020 erreicht.
Mit 442 Kernkraftwerken war weltweit Ende 2020 in 33 Ländern ein Block weniger in Betrieb als ein Jahr zuvor. Mit 451 Kernkraftwerksblöcken waren in 2018 so viele Anlagen in Betrieb wie noch nie seit Inbetriebnahme des ersten rein kommerziellen Kernkraftwerks Calder-Hall 1 in Großbritannien im Jahr 1956.
Im Einzelnen sind fünf Blöcke kritisch geworden und wurden erstmals mit dem Stromnetz synchronisiert: zwei Blöcke in China: Fuqing 5 und Tianwan 5, ein Block in Russland: Leningrad 2-2, ein Block in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Barakah 1 und ein Block in Weißrussland: Belarusian 1. Sechs Kernkraftwerksblöcke stellten ihren Betrieb ein: In Frankreich nach 43 Jahren erfolgreichem Betrieb die Kernkraftwerksblöcke Fessenheim 1 und 2; in Russland der RBMK-Block Leningrad 2; in Schweden die Anlage Ringhals 1 und in den USA die zwei Blöcke Duane Arnold 1 und Indian Point 2.
Bei den Stromerzeugungskapazitäten lag die Bruttoleistung der Kernenergie weltweit mit 419.035 MWe deutlich über der Marke von 400.000 MWe.
Ein erneut gutes Ergebnis kann die Kernenergie auch bei der Stromerzeugung verzeichnen. Mit einer Nettoerzeugung von über 2.555 TWh lag diese geringfügig niedrigere als im Vorjahr mit 2.567 TWh. Aufgrund von seit 2011 weiterhin nicht in Betrieb befindlichen 29 Kernkraftwerke in Japan ist diese aber noch niedriger als vor dem Tsunami und Unfall in Fukushima.
Der Anteil an der gesamten weltweiten Stromproduktion lag weiterhin bei 11 %; der Anteil der Kernenergie an der gesamten weltweiten Energieversorgung bei rund 4,5 % – dies sind zwei sicherlich bemerkenswerte Zahlen: Die 417 derzeit aktiven Kernkraftwerke sind in der Lage, jeden zehnten Menschen weltweit mit Strom zu versorgen oder jeder zwanzigste Mensch weltweit deckt seinen Energiebedarf komplett mit Kernenergie. Regional und in den einzelnen Kernenergie nutzenden Ländern ist der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung mit einer Spannbreite von inzwischen 6 % in China – eine Verdoppelung innerhalb von 5 Jahren – bis fast 71 % in Frankreich unterschiedlich. 13 Staaten decken mehr als 30 % ihrer Stromerzeugung nuklear. Europa ist weiterhin mit 179 Reaktoren die bedeutendste Kernenergie nutzende Region. In ihr wird mit einem Anteil von rund 26 % rund jede vierte verbrauchte Kilowattstunde Strom in Kernkraftwerken erzeugt.
Bei den neu begonnenen Projekten sind für das Jahr 2020 fünf Vorhaben zu verzeichnen: In China wurden Bauarbeiten an den vier Blöcken Sanaocun 1 (neuer Standort), Shidaowan 2, Taipingling 2 und Zhangzhou 2 aufgenommen, in der Türkei begann der Bau des zweiten Blocks am Standort Akkuyu.
Damit waren weltweit 54 Kernkraftwerksblöcke mit 58.712 MWe Brutto- und 54.803 MWe Nettoleistung in Bau; aufgrund der Neuinbetriebnahmen einer weniger als ein Jahr zuvor. Darüber hinaus sind rund 135 Neubauprojekte zu verzeichnen, die sich im erweiterten Planungsstadium befinden.