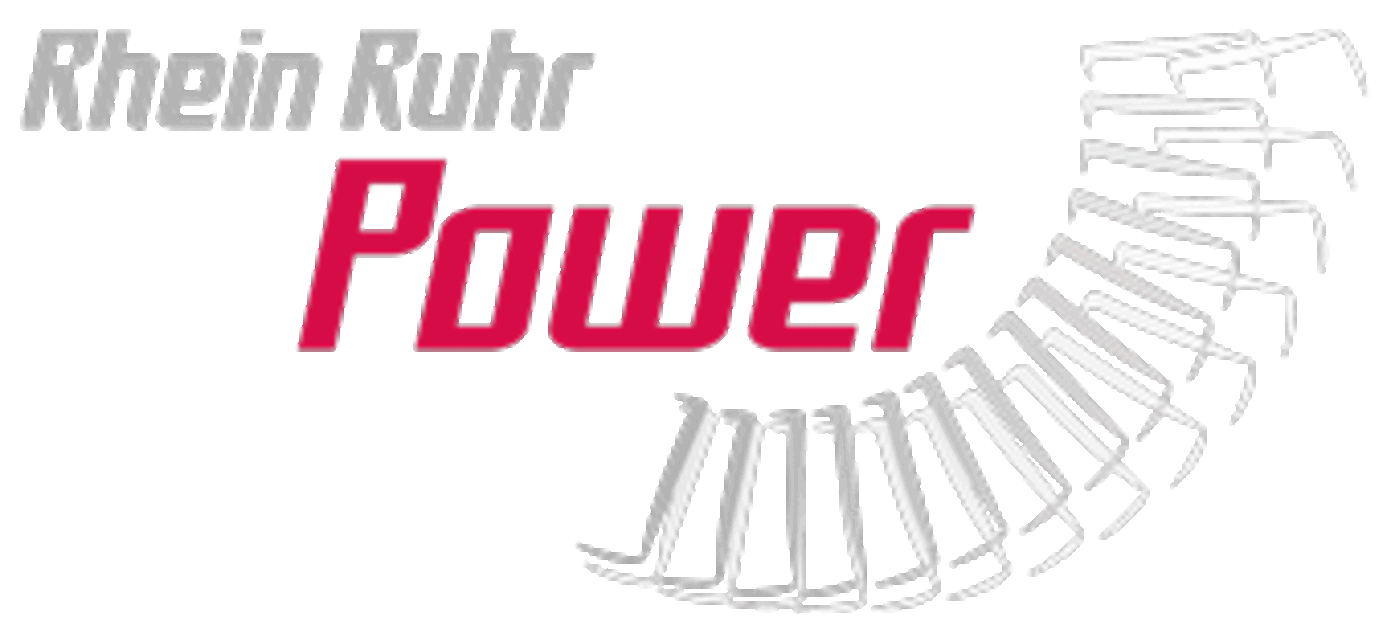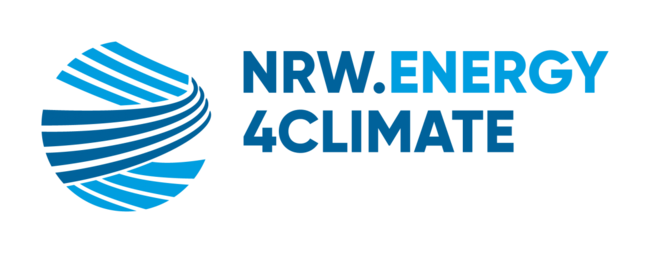Carbon-Capture-Technologie
Nach dem „Übereinkommen von Paris“ ist spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Treibhausgasemissionen und deren Aufnahme durch natürliche oder technische Senken zu erreichen – ein Zustand, der als Treibhausgasneutralität bezeichnet wird. Drei Strategien stehen hierfür grundsätzlich zur Verfügung:
- Vermeidung von Emissionen durch reduzierten Verbrauch von Produkten oder Reduktion von Aktivitäten, die zu Treibhausgasemissionen führen,
- Ersetzen (Substitution) von treibhausgasintensiven durch treibhausgasneutrale oder treibhausgasarme Techniken und Produkte,
- Schaffung von CO2-Senken, d.h. die Entnahme von bereits emittiertem CO2 aus der Atmosphäre.
Bei der Diskussionen über Klimaerwärmung wird CO2 als wichtigstes Treibhausgas angesehen. Zur Verringerung des CO2-Ausstoßes sollen insbesondere Technologien mit höherer Energieeffizienz sowie die Nutzung Erneuerbarer Energie zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden auch Möglichkeiten zur Abscheidung und anschließenden Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) untersucht.
Eine weitere Alternative zu CCS, die zur aktiven Verringerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre beitragen kann, ist die CO2-Abscheidung und Verwendung (Carbon Capture and Utilisation, CCU). Hierbei wird CO2 nicht nur als abzuscheidendes Treibhausgas betrachtet, sondern auch als wertvoller Rohstoff, der durch Carbon Capture gewonnen wird. Während einige CCU-Technologien, wie die Methanol- oder Fischer-Tropsch-Synthese, bereits einen hohen Reifegrad (TRL ≥ 8) erreicht haben, befinden sich andere Ansätze noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Langfristig können diese Technologien insgesamt jedoch eine wichtige Rolle im CO2-Stoffkreislauf spielen.
Besonders für energieintensive Industrien mit hohem CO2-Ausstoß, wie die Stahl-, Zement- und Kalkindustrie, Kraftwerke und Heizkraftwerke, Papierfabriken sowie Chemieanlagen sind Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Technologien von besonderem Interesse.
Bislang ist die Nutzung von CO2 weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene umfassend geregelt. Nach dem Eckpunktepapier des BMWK für eine Carbon-Management-Strategie aus Februar 2024 sollen mögliche Einsatzgebiete für CCU und CCS sowie die rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen – möglichst im Einklang mit europäischen und internationalen Standards und Regelungen – für einen erfolgreichen Hochlauf einer CCUS-Industrie identifiziert werden.

Dauerhafte Speicherung von CO2
Das Ziel der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO2) ist die Reduzierung der CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Das gespeicherte CO2 kann wie oben beschrieben aus verschiedenen Quellen stammen. Mögliche Speichermöglichkeiten sind teilweise oder vollständig erschöpfte Öl- und Gaslagerstätten sowie saline Aquifere. CO2 kann sowohl an Land als auch im Meeresuntergrund gespeichert werden. Die Entwicklung einer CO2-Infrastruktur ist eine große Herausforderung für die Entwicklung von CCS-Projekten und muss vor allem in Europa entsprechend vorangetrieben werden. Lange Planungs- und Genehmigungszeiten, noch nicht vollständig ausgearbeitete Rechtsvorschriften sowie Vorbehalte in der Öffentlichkeit gegenüber Pipelines und Onshore-Speichern erhöhen Kosten und Risiken bei der Projektentwicklung. Umfangreiche Pilotprojekte zur CO2-Speicherung verbessern die öffentliche Wahrnehmung und tragen zur Weiterentwicklung des Fachwissens im Hinblick auf Design und Betrieb bei.

CO2 als Rohstoff

Kraftwerkstechnologien mit CO2-Abtrennung als Rohstoff
Derzeit stehen drei Hauptverfahren zur Verfügung, die sich in ihrer technologischen Umsetzung und ihrem Einsatzpotenzial unterscheiden:
Beim Oxyfuel-Verfahren wird bei der Verbrennung reiner Sauerstoff anstelle von Luft eingesetzt. Dies führt zu einem Abgasstrom, der hauptsächlich aus CO2 und Wasserdampf besteht, wodurch die CO2-Abscheidung erleichtert wird. In diesem Verfahren können sowohl fossile Brennstoffe als auch Biomasse oder Abfall als Energieträger genutzt werden. Derzeit ist das Verfahren noch nicht wirtschaftlich und wird vor allem in Pilotprojekten untersucht.
Carbon-Capture-Technologien in der Entwicklung:
Das Membrantrennverfahren nutzt spezielle Membranen, die selektiv CO2 aus Gasgemischen abtrennen. Dabei diffundiert das CO2 durch die Membran, während andere Gase wie Stickstoff oder Sauerstoff weitgehend zurückgehalten werden. Der Prozess beruht auf physikalischen Eigenschaften wie der Löslichkeit und der Diffusionsfähigkeit der Gase in der Membran.
Es eignet sich besonders für Anlagen mit niedrigem bis mittlerem CO2-Gehalt im Abgasstrom und wird derzeit in der Pilotphase getestet. Darüber hinaus befinden sich verschiedene Membrantypen in der Entwicklung.
Das Carboante Looping wird auch als Trockenabsorptionsverfahren bezeichnet und zählt zu den Nachverbrennungsverfahren. Es basiert auf der reversiblen Reaktion von Calciumoxid (CaO) und Kohlendioxid (CO2) zu Calciumcarbonat (CaCO3). In einem Zyklus wird CO₂ aus Abgasen durch Reaktion mit CaO in einem Karbonator gebunden. Anschließend wird das gebildete CaCO3 in einem Kalzinator thermisch zersetzt, wobei CO2 für die Weiterverarbeitung oder Speicherung freigesetzt wird, während das regenerierte CaO wiederverwendet wird. Dieses Verfahren ermöglicht eine effiziente CO2-Abtrennung mit vergleichsweise geringem Energieaufwand und kann in bestehende Kraftwerke integriert werden.
Mit dem Direct-Air-Capture-Verfahren (DAC) wird CO2 direkt aus der Atmosphäre gefiltert. Dabei wird die Umgebungsluft angesaugt und durch einen Filter geleitet.
Zwei verschiedene Varianten kommen zum Einsatz:
- CO2 wird durch ein festes Adsorptionsmittel bei einer Temperatur von 80 bis 120 °C gefiltert oder
- CO2 wird durch ein flüssiges Lösungsmittel bei einer Temperatur von 300 bis 900 °C abgeschieden
Aktivitäten
Der Erfahrungsaustausch und insbesondere die Entwicklung praxisorientierter Lösungen für den Einsatz von CCUS-Technologien ist eine der Kernaufgaben unserer Verbandsarbeit.
Bereits in der Vergangenheit arbeitete vgbe in der ZERO EMISSIONS PLATFORM (ZEP) mit. Die ZEP ist eine europäische Initiative, die 2005 gegründet wurde, um den Einsatz von CCUS zu fördern. Sie vereint Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten, um technische, wirtschaftliche und politische Strategien zur Förderung der Treibhausgasreduktion durch CCUS-Technologien zu entwickeln. Ziel ist es, die Erreichung der EU-Klimaziele zu unterstützen und die Entwicklung von CCUS als wichtigen Bestandteil einer nachhaltigen Energiezukunft voranzutreiben.
Dank der in diesem Gremium gesammelten Erfahrungen spielt vgbe eine zentrale Rolle bei der Beratung und Unterstützung seiner Mitglieder in der Auswahl, Auslegung und Optimierung von CCUS-Technologien sowie bei der Bewältigung aktueller ökologischer und strategischer Herausforderungen.
Folgende Kernthemen stehen im Fokus:
- Auswahl und Auslegung von baulichen und technischen Anlagen
- Entwicklung von Konzepten für einen optimierten Betrieb und die Instandhaltung
- Verbesserung von Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Unterstützung eines kosteneffizienten Lebenszyklus- und Umweltmanagements
- Initiierung von Forschungsprojekten zu interessanten Zukunftsthemen
- Einbringung von Positionen in europäischen und nationalen Regelsetzungen
vgbe-Regelwerke geben den Stand der Technik für die Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme wieder. Sie werden in enger Kooperation mit Betreibern und Herstellern erarbeitet.
Anwendungsbereiche sind u.a.:
- Auslegung, Design und Planung
- Einkauf und Herstellung
- Errichtung und Inbetriebnahme
- Betrieb und Instandhaltung
- Rückbau und Recycling
Für ordentliche Mitglieder des vgbe energy ist der Bezug des vgbe-Regelwerks in elektronischer Form (eBook) im Mitgliedsbeitrag enthalten. Außerordentliche und fördernde vgbe-Mitglieder erhalten das vgbe-Regelwerk zu vergünstigten Konditionen.
Übersicht aller vgbe-Standards finden Sie im Medienverzeichnis!
Um neuen Herausforderungen zu begegnen, bietet vgbe energy Forschungskooperationen an, in denen sowohl Betreiber als auch Hersteller, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die öffentliche Hand ihr Fachwissen und ihre finanziellen Ressourcen bündeln. Dies umfasst die Initiierung und Koordination nationaler und internationaler Forschungsprojekte, den Wissensaufbau und -transfer sowie Kosteneinsparungen durch gemeinsame Forschungsinitiativen.
vgbe energy organisiert themenspezifische Expert Workshops, die den Austausch und die Entwicklung praxisnaher Lösungen auf höchstem technischem Niveau fördern.
Die Expert Workshops werden in Zusammenarbeit mit den vgbe-Mitgliedern geplant und decken ein breites Anwendungsspektrum mit etablierten und neuen Technologien zur Energieumwandlung und -speicherung ab. Diese Workshops können kurzfristig organisiert werden und greifen daher nicht nur drängende Fragen der Branche auf, sondern können auch proaktiv genutzt werden, um Lösungen für anstehende Herausforderungen zu finden. Ein wesentliches Merkmal der Expert Workshops ist das Prinzip des Gebens und Nehmens: Die aktive Teilnahme setzt einen obligatorischen Vortrag und die anschließende Diskussion voraus.
Das Verständnis und die Umsetzung von Best Practices in Betrieb und Entwicklung gehören zu den Kernthemen von vgbe. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern hat vgbe verschiedene Technische Programme ins Leben gerufen, die sowohl vgbe-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern offenstehen. Diese Programme unterstützen die Energiebranche aktiv bei technisch-ökonomischen und ökologischen Herausforderungen – von der Optimierung des Anlagenbetriebs über Instandhaltung und Effizienzsteigerung bis hin zur Gestaltung des Future Energy System.
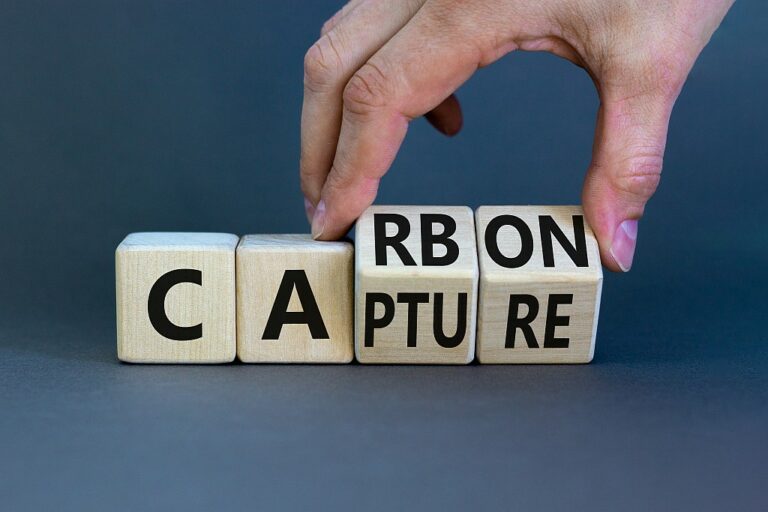




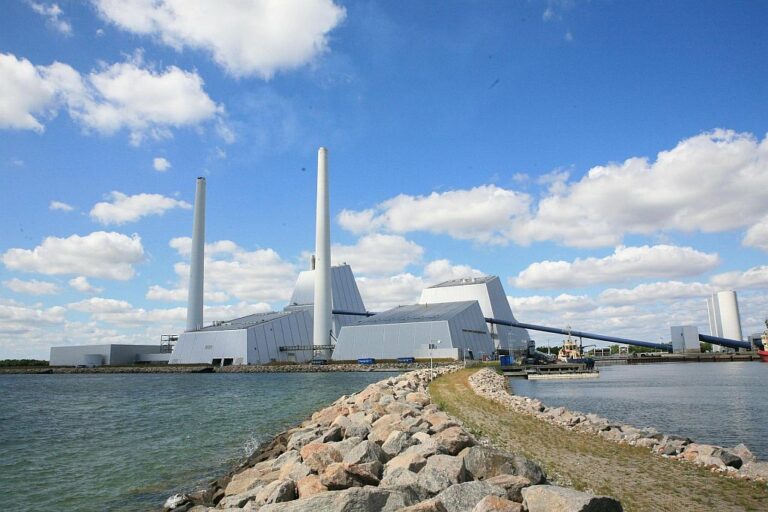


Technical Competence Center „Future Energy System“
Das Technical Committee „Carbon Capture, Utilisation and Storage“ ist Teil unseres Technical Competence Centers (TCC) „Future Energy System“. Es ist Ziel der Aktivitäten des TCC eine Interessens- und Kommunikationsplattform für Unternehmen zu schaffen, die sich für die Förderung, Umsetzung und den Betrieb von Zukunftstechnologien im Industrie und Energiesektor engagieren.
Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Sprechen Sie uns an
Wir beraten Sie gerne
Unser Team
Sebastian Zimmerling
Leiter Future Energy System
Agnes Goeritz
Assistentin Future Energy System