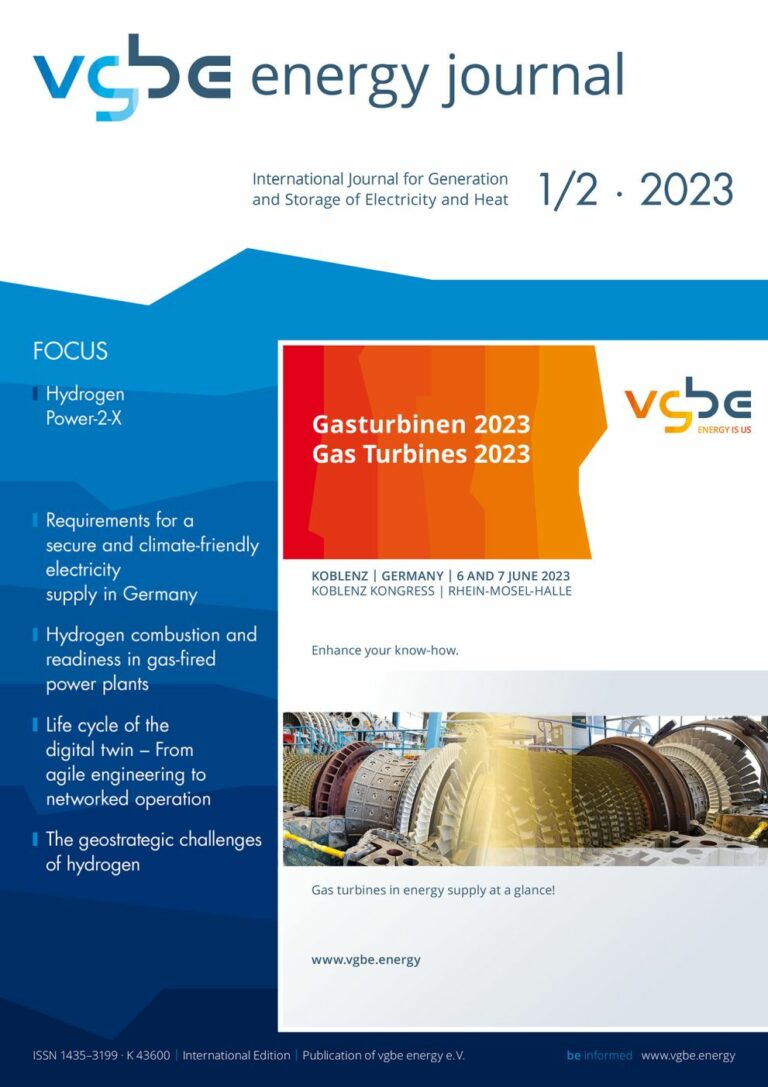Versorgungssicherheit braucht ein neues Marktdesign
Kerstin Andreae
Um die Transformation der Strom- und Wärmeversorgung hin zur Klimaneutralität zu meistern, braucht es Investitionen in wasserstofffähige Gaskraftwerke und Biomasse-Anlagen. Denn klar ist: Um die Versorgungssicherheit in jeder Stunde des Jahres sicherzustellen, benötigen wir neue Kraftwerke, die die gesicherte, regelbare Leistung in den Strom- und Wärmenetzen als Partner der Erneuerbaren Energien gewährleisten. Es geht darum, auch die gesicherte Leistung klimaneutral zu organisieren.
Das Gelingen der Energiewende und ihre Akzeptanz werden mit davon abhängen, dass auch die verbleibende Residuallast sicher und klimaneutral gedeckt wird. Mit dem Vollzug des Kohleausstiegs in den Jahren nach 2024 wird der Bedarf an neuen gesicherten Erzeugungskapazitäten als Komplementäre zu Erneuerbaren Energien steigen. Können sie nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte das hohe Klimagasemissionen zur Folge, weil der längere Betrieb von Kohlekraftwerken die Folge wäre.
Anforderungen an eine sichere und klimagerechte Stromversorgung in Deutschland
Hans-Wilhelm Schiffer
Das deutsche Energiesystem soll durchgreifend umgebaut werden: Durch konsequente Fortführung des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf einen Anteil von 80 % am Bruttostromverbrauch bis 2030 wird in Deutschland ein nahezu treibhausgasneutrales Stromsystem bis 2035 angestrebt. Dieses Ziel soll unter Aufrechterhaltung der Sicherheit der Versorgung erreicht werden. Dieser Artikel analysiert, welche Optionen zur Lösung dieser Aufgabe zur Verfügung stehen, welche Potenziale sie mitbringen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Transformation gelingt. So braucht eine Stromversorgung auf Basis von Wind und Sonne als dominierenden erneuerbaren Energieträgern eine Absicherung zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit auch in Zeiten von Dunkelflaute. Dazu gehören eine ausreichende Stromerzeugungsleistung verbunden mit hinreichenden Flexibilitätsoptionen, eine verlässliche Brennstoffversorgung der Kraftwerke mit gesicherter Leistung, sowie eine widerstandsfähige Transport- und Verteilnetz-Infrastruktur. Aufgrund des gesetzlich vorgezeichneten Abbaus von konventioneller Stromerzeugungsleistung bei gleichzeitig zunehmender Elektrifizierung öffnet sich ohne geeignete Gegenmaßnahmen eine Schere zwischen der Höhe der gesicherten Leistung und der im Netz zu erwartenden Höchstlast. Zur Sicherstellung der Stromversorgung ist ein Ausbau der Gaskraftwerksleistung erforderlich.
Lebenszyklus des digitalen Zwillings – Vom agilen Engineering zum vernetzten Betrieb
Johanna Kiesel
Der Begriff Zwilling sagt es: Die digitale Version einer (Teil-) Anlage sollte stets das Ebenbild des physischen Zwillings sein. Die Realität sieht jedoch meist anders aus. Auch digitale Modelle veralten im Nu, wenn Änderungen an der realen Anlage, etwa ein Gerätetausch, nicht übertragen werden. Schnell wird so der ehemalige Zwilling zur älteren Schwester; die Informationsbasis, die mit viel Aufwand und Know-how einmal das – im besten Fall – gesamte Anlagenwissen beinhaltete, verliert mit der Verlässlichkeit auch ihren enormen Wert. Das lässt sich zum Glück vermeiden – mit disziplinübergreifend zentrierten Daten und Webservice-Orientierung.
Wasserstoffverbrennung und Readiness von Gaskraftwerken
Erik Zindel, Ertan Yilmaz, Jenny Johansson und Johan Leirnes
Innovative und sichere Wasserstoffarmaturen-Technologie für industrielle Thermoprozessanwendungen und H2-Mischgase
Uwe Krabbe, Jan Schröder und Jürgen Wolko
Methoden der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) zur sicherheitstechnischen Bewertung von Anlagen
Bert Geyer, Manuela Jopen, Thomas Schimpfke, Burkhard Forell und Frank Michel
Wie effizient kann Wasserstoff sein?
Herausforderungen der ganzheitlichen Effizienzbewertung und -optimierung
Natascha Eggers, Torsten Birth und Antonio Hurtado
IT-Security für KRITIS
Datenschutz = Katastrophenschutz
Christian Stüble
Globaler Kohlenstoffmarkt erreicht 2022 trotz weniger Transaktionen einen Rekordwert von 865 Mrd. Euro
Yan Qin, Tatiana Suarez Lopez, Maria Kolos, Luyue Tan, Yoko Nobuoka und Lisa Zelljadt
Die geostrategischen Herausforderungen von Wasserstoff
Enerdata
Wasserstoff wird von vielen als wirksame Lösung für die Dekarbonisierung umweltbelastender Sektoren angesehen. Viele Länder haben diesen Energievektor zu einem zentralen Element ihrer Energiewende-Strategie gemacht, um die industriellen Emissionen drastisch zu reduzieren, Strom zu speichern und die Mobilität von morgen voranzutreiben. Erneuerbarer Wasserstoff bricht die Regeln, da er fast überall produziert werden kann und somit die Energiegeopolitik verändert. Die europäischen Länder wollen sich an dieser grünen Revolution beteiligen und haben große Investitionen angekündigt, wie z. B. Frankreich mit 7 Milliarden Euro bis 2030. Der Wettlauf um die Vorherrschaft in dieser Branche wird auch Japan, China, Südkorea und die Vereinigten Staaten mit einbeziehen, die ebenfalls ihre Führungsrolle durchsetzen wollen. In diesem Artikel legen wir den Grundstein für die mögliche zukünftige Geopolitik und Geowirtschaft des Wasserstoffs. Da die ganze Welt über Wasserstoff nachdenkt, werden wir versuchen zu verstehen, wie die Wasserstoffwirtschaft aussehen könnte und welche Länder den Markt beherrschen könnten. Schließlich werden wir neue geostrategische Abhängigkeiten aufzeigen, die sich für die Europäische Union ergeben könnten, und wie sie mit ihnen umzugehen gedenkt.
Editorial

Kerstin Andreae
Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Berlin
Versorgungssicherheit braucht ein neues Marktdesign
Liebe Leserinnen und Leser,
Um die Transformation der Strom- und Wärmeversorgung hin zur Klimaneutralität zu meistern, braucht es Investitionen in wasserstofffähige Gaskraftwerke und Biomasse-Anlagen. Denn klar ist: Um die Versorgungssicherheit in jeder Stunde des Jahres sicherzustellen, benötigen wir neue Kraftwerke, die die gesicherte, regelbare Leistung in den Strom- und Wärmenetzen als Partner der Erneuerbaren Energien gewährleisten. Es geht darum, auch die gesicherte Leistung klimaneutral zu organisieren.
Das Gelingen der Energiewende und ihre Akzeptanz werden mit davon abhängen, dass auch die verbleibende Residuallast sicher und klimaneutral gedeckt wird. Mit dem Vollzug des Kohleausstiegs in den Jahren nach 2024 wird der Bedarf an neuen gesicherten Erzeugungskapazitäten als Komplementäre zu Erneuerbaren Energien steigen. Können sie nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte das hohe Klimagasemissionen zur Folge, weil der längere Betrieb von Kohlekraftwerken die Folge wäre.
Studien aus dem Jahr 2021 gehen von einem Zubaubedarf an gesicherter Leistung in Höhe von rund 20 bis 40 Gigawatt (GW) in Deutschland aus. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sieht ebenfalls den Bedarf für Zubau an gesicherter Leistung. Allerdings stand der Reduzierung durch Kohle- und Kernenergieausstieg in den letzten Jahren kein Zubau gegenüber, der zum Ausgleich nötig gewesen wäre.
Nach unserer Einschätzung ist der erforderliche beträchtliche Zubau neuer steuerbarer Erzeugungskapazitäten unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht rechtzeitig bis 2030 zu realisieren. Unter den aktuellen Marktbedingungen fehlt die Wirtschaftlichkeit für Investitionen in solche Erzeugungskapazitäten. Der Energy-Only-Market setzt nicht die notwendigen Investitionsanreize. Für die Refinanzierung von Investitionen in gesicherte Leistung brauchen wir deshalb schnell ein neues Marktdesign.
Der genaue Zubaubedarf hängt darüber hinaus von einer Vielzahl von Faktoren und Annahmen ab, wie Strombedarfsänderung (E-Mobilität, Wärmepumpen), Ausbau der Erzeugungskapazitäten aus Erneuerbaren Energien (EE) oder gesicherter EE-Leistung (Biomasse). Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es bei der Frage nach der notwendigen Menge an gesicherter Kraftwerkskapazität zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit um die Abdeckung der höchsten Residuallast in spezifischen Stunden des Jahres geht. Dabei ist die Kapazität bzw. Leistung dieser Residualkraftwerke (in GW) relevant, nicht (wie oft betrachtet) deren Stromproduktion über das gesamte Jahr (in TWh).
Laut Koalitionsvertrag 2021 soll die Plattform klimaneutrales Stromsystem einen Vorschlag für „ein neues Strommarktdesign“ vorlegen. Ziel muss es aus unserer Sicht sein, bereits im Laufe des Jahres 2023 zu Ergebnissen zu kommen, die schnell in einen operativen Investitionsrahmen münden müssen, damit Investitionsentscheidungen für Kraftwerke auf einer klaren rechtlichen Grundlage getroffen werden können. Hierzu kommt vor allem ein Kapazitätsmechanismus in Betracht. Der BDEW setzt sich derzeit mit Kriterien auseinander, die ein solcher Kapazitätsmechanismus erfüllen sollte.
Ein entsprechender Mechanismus muss bis Ende 2023 so weit erarbeitet sein, dass entsprechende Gesetzgebungen rechtzeitig in Kraft sind, um Investitionen anzureizen, die bis 2030 umgesetzt sind. Die Zeit drängt: Die Projektrealisierungszeiten im Kraftwerksbau betragen zwischen 4 und 7 Jahre.
Unbedingt vermieden werden sollte eine Situation, die zu überstürztem Handeln zwingt und eine schnelle Errichtung von Erzeugungsanlagen außerhalb des Marktes, beispielsweise finanziert über Netzentgelte, erforderlich macht. Dies würde den Markt (erneut) empfindlich stören und durch eine solche zusätzliche „Reserve“ das Ziel der Regierungskoalition, die Netzentgelte zu senken, konterkarieren.
Wie unter einem Brennglas hat der Krieg in der Ukraine gezeigt, was ansteht, um dem energiewirtschaftlichen Dreieck gerecht zu werden, bei dem alles unter Druck geraten ist: Klimaneutralität bedeutet, den Ausbau bei den Erneuerbaren in einem Maße zu beschleunigen, wie wir es bis heute nicht kennen. Versorgungssicherheit heißt, kurzfristig Ersatz für russisches Gas, russische Kohle und russisches Öl zu beschaffen, aber langfristig einen Investitionsrahmen für eine stabile Deckung der Residuallast zu setzen, der Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit gibt. Und Bezahlbarkeit adressiert, dass Deutschland immer auch die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie wie auch die soziale Frage im Blick haben muss. Die 2020er Jahre werden damit zum herausforderndsten Jahrzehnt der Energiewende.