Neue Herausforderungen für Europas Energieversorgung – EU Clean Industrial Deal
Christopher Weßelmann
Die Europäische Kommission hat jetzt ihren seit längerem angekündigten Clean Industrial Deal vorgestellt, eine strategische Initiative, die Dekarbonisierung mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbindet. Das umfassende Paket umfasst einen Aktionsplan für erschwingliche Energie und das Omnibus-Paket, die beide darauf abzielen, die Nachhaltigkeitsziele und die EU-Investitionen zu vereinfachen.
Im Zentrum des Clean Industrial Deal stehen sechs zentrale Säulen, die sich mit den aktuellen industriellen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas befassen. Diese Säulen konzentrieren sich auf den Zugang zu bezahlbarer Energie, die Entwicklung von Leitmärkten für sauberes Angebot und saubere Nachfrage, die Förderung öffentlicher und privater Investitionen, die Sicherstellung des Zugangs zu wichtigen Materialien und Ressourcen, die Stärkung globaler Märkte und Partnerschaften sowie die Förderung von Beschäftigung und Qualifikationen. Zu den Maßnahmen, mit denen diese Ziele unterstützt werden sollen, gehören eine Überprüfung des CO2-Emissionshandels, die Einführung eines europäischen Netzausbaupakets und Investitionsprogramme der Europäischen Investitionsbank. Ein zentrales Ziel ist die Erhöhung der Elektrifizierungsrate auf 32 Prozent bis 2030, verbunden mit erweiterten Garantien für Strombezugsverträge, die nun auch die Kernenergie einschließen. Einige der vorgeschlagenen Änderungen, wie die Entkopplung von Gas- und Strompreisen und die Anpassung der Netztarife, bedürfen jedoch einer sorgfältigen Bewertung.
Instandhaltungsstrategien für Regelkraftwerke – Längere Lebensdauer, optimierter Betrieb
Franz Binder
Mit flexiblem Betrieb auf die Anforderungen eines dynamischen Strommarktes zu reagieren, gehört für die Betreiber thermischer Kraftwerke inzwischen zum Alltag. Einerseits entstehen durch die Herausforderungen in der Fahrweise höhere Belastungen für drucktragende Bauteile, die sich signifikant auf die Lebensdauer auswirken. Andererseits ist das Geschäft, Residuallasten zu decken, lukrativ. Mit Schnellstartfähigkeit und noch höheren geforderten Leistungsänderungsgeschwindigkeiten wird insbesondere der Betrieb neuer Gaskraftwerke noch anspruchsvoller. Es gilt, eine möglichst optimale Balance zu finden zwischen vorausschauend-sicherem Betrieb und der Erfüllung dieser Zielsetzungen im Sinne der Gesamtwirtschaftlichkeit. Dafür hat TÜV SÜD in Zusammenarbeit mit einem kommunalen Energieversorger das auf Außentemperaturmessungen basierende Erschöpfungsmonitoring von Bauteilen gezielt weiterentwickelt.
Kohlekraftwerke können ihren fossilen CO2-Footprint senken
Hellmuth Brüggemann, Martin Käß und Ingo Dreher
Industriereinigung-Einsatz flüssiger Reinigungsmittel – Erfahrungen
Hans-Jürgen Kastner
Umstellung von fossil-befeuerten Dampferzeugern auf alternative Brennstoffe
Joonas Hämäläinen
Seltene Erden – Rückgewinnung aus kohlebasierten Materialien
Stephen Mills
Dieser Bericht befasst sich mit der strategischen Bedeutung und der wachsenden globalen Nachfrage nach Seltenerdelementen (SEE), die für viele High-Tech-Geräte und Verteidigungsanwendungen unverzichtbar sind. Sie sind auch ein entscheidender Bestandteil der Energiewende und werden in Technologien für erneuerbare Energien wie Solarmodulen, Windturbinen, Elektrolyseuren und Elektrofahrzeugen eingesetzt. Viele Studien zeigen die Rückgewinnung von Seltenerdmetallen aus verschiedenen kohlebezogenen Materialien auf, darunter Steinkohle und Braunkohle, Kohleabfälle, Grubenwasser und Nebenprodukte der Kohleverbrennung wie Flugasche.
Kohle als Ressource: Vergasung und Chemikalien
Ian Reid
SachsenEnergie macht Leitwarte fit für die Zukunft
Jungmann Systemtechnik
Wasserstoffversprödung in Edelstahlrohren: Normen und Standards sind entscheidend
Werner Hannig
Wie die Elektrifizierung der Industrie erleichtert werden kann: Ein Vorschlag für eine EU-Elektrifizierungsbank
Eurelectric
Die wachsende Rolle von Erdgas bei der Bewältigung des Dunkelflauten-Dilemmas und der Verbesserung der Energiesicherheit
GEFC Gas Exporting Countries Forum
Review des vgbe Expert Event “Storage 2024”
vgbe energy
Das Webinar “Maximising Efficiency: The Potential of Storage Technologies in Power-to-Heat-to-Power Systems” befasste sich mit der zentralen Frage: Welche Rolle können Speichertechnologien, insbesondere Power-to-Heat-to-Power-Systeme, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen? Führende Forschungseinrichtungen präsentierten einen umfassenden technischen und wissenschaftlichen Überblick über den Stand der Technik und künftige Fortschritte.
Review des vgbe Expert Event “Digitalisation in Hydropower 2024”
vgbe energy
Die 7. Veranstaltung „Digitalisation in Hydropower – Innovative data-driven measures for performance optimisation and resilience“ brachte mehr als 140 führende Wasserkraftbetreiber und Herstellerfirmen aus Europa und dem Ausland zusammen, um Wissen über die erfolgreiche Implementierung neuer digitaler Lösungen zu teilen.
Editorial
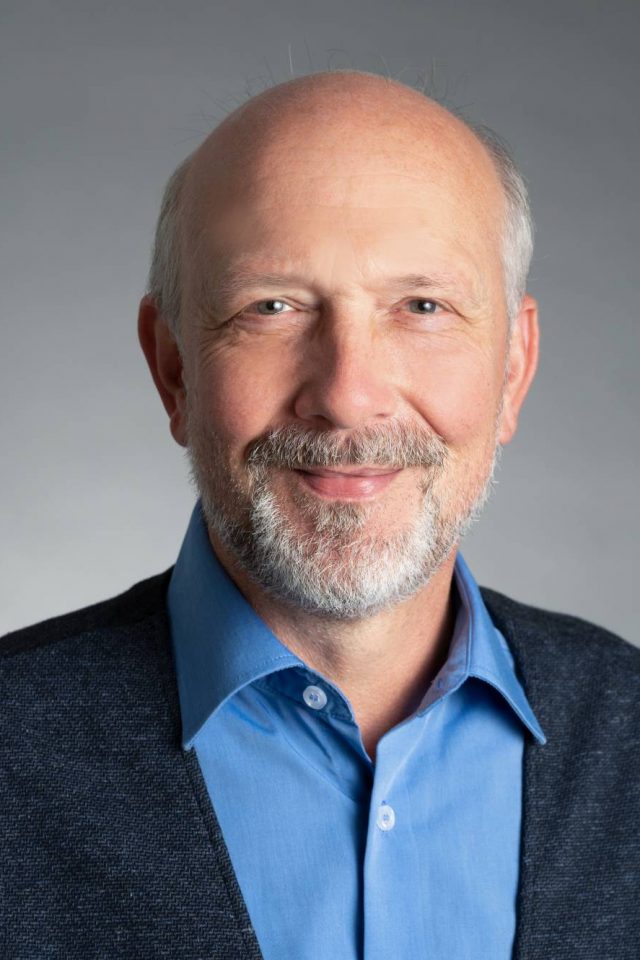
Christopher Weßelmann
Chefredakteur vgbe energy
Neue Herausforderungen für Europas Energieversorgung – EU Clean Industrial Deal
Liebe Leserinnen und Leser,
Die Europäische Kommission hat jetzt ihren seit längerem angekündigten Clean Industrial Deal vorgestellt, eine strategische Initiative, die Dekarbonisierung mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbindet. Das umfassende Paket umfasst einen Aktionsplan für erschwingliche Energie und das Omnibus-Paket, die beide darauf abzielen, die Nachhaltigkeitsziele und die EU-Investitionen zu vereinfachen.
Im Zentrum des Clean Industrial Deal stehen sechs zentrale Säulen, die sich mit den aktuellen industriellen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas befassen. Diese Säulen konzentrieren sich auf den Zugang zu bezahlbarer Energie, die Entwicklung von Leitmärkten für sauberes Angebot und saubere Nachfrage, die Förderung öffentlicher und privater Investitionen, die Sicherstellung des Zugangs zu wichtigen Materialien und Ressourcen, die Stärkung globaler Märkte und Partnerschaften sowie die Förderung von Beschäftigung und Qualifikationen. Zu den Maßnahmen, mit denen diese Ziele unterstützt werden sollen, gehören eine Überprüfung des CO2-Emissionshandels, die Einführung eines europäischen Netzausbaupakets und Investitionsprogramme der Europäischen Investitionsbank. Ein zentrales Ziel ist die Erhöhung der Elektrifizierungsrate auf 32 Prozent bis 2030, verbunden mit erweiterten Garantien für Strombezugsverträge, die nun auch die Kernenergie einschließen. Einige der vorgeschlagenen Änderungen, wie die Entkopplung von Gas- und Strompreisen und die Anpassung der Netztarife, bedürfen jedoch einer sorgfältigen Bewertung.
Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist der Aktionsplan für bezahlbare Energie, der sich auf die Umsetzung der Strommarktreformen konzentriert. Der Plan zielt darauf ab, langfristige, technologieoffene Verträge zu fördern, die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien, Speicher und den Netzausbau zu beschleunigen und den heimischen Energiemarkt zu stärken, um die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern. Trotz der vielversprechenden Ansätze gibt es Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen harmonisierten Netztarifmethodik, die nationale Besonderheiten nicht berücksichtigt und die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Festlegung der Tarife beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus könnten die Empfehlungen zur Reduzierung der Spitzennachfrage unter normalen Marktbedingungen das Potenzial der Nachfragesteuerung einschränken.
Das Omnibus-Paket, ein weiterer zentraler Aspekt des Clean Industrial Deal, zielt darauf ab, regulatorische Belastungen, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, zu reduzieren. Es sieht Änderungen der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, der EU-Taxonomie und der Richtlinie zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht vor. Ziel ist es, die Berichtspflichten insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen zu reduzieren. Die Anpassungen des CO2-Grenzausgleichsmechanismus umfassen einen angepassten Erfüllungsmechanismus, Änderungen der Berechnungsmethoden und den Wegfall von Strom aus der indirekten Emissionsberichterstattung. Im Bereich der Investitionen konzentriert sich der Vorschlag auf die Aufstockung der Mittel für nachhaltige Infrastruktur durch InvestEU und schätzt, dass die Gesetzesänderungen zusätzliche 50 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen freisetzen könnten. Die konkrete Verteilung dieser Mittel bleibt jedoch unklar.
Diese Initiative markiert den Beginn einer umfassenderen Strategie der Europäischen Kommission zur Förderung einer kohlenstoffarmen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Während nicht alle Elemente des Clean Industrial Deal einer gesetzlichen Genehmigung bedürfen, wird erwartet, dass die Kommission eine aktive Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen durch politische Empfehlungen und Investitionsrahmen übernimmt.
Der Weg zu einer saubereren und wettbewerbsfähigeren europäischen Wirtschaft hat gerade erst begonnen.
