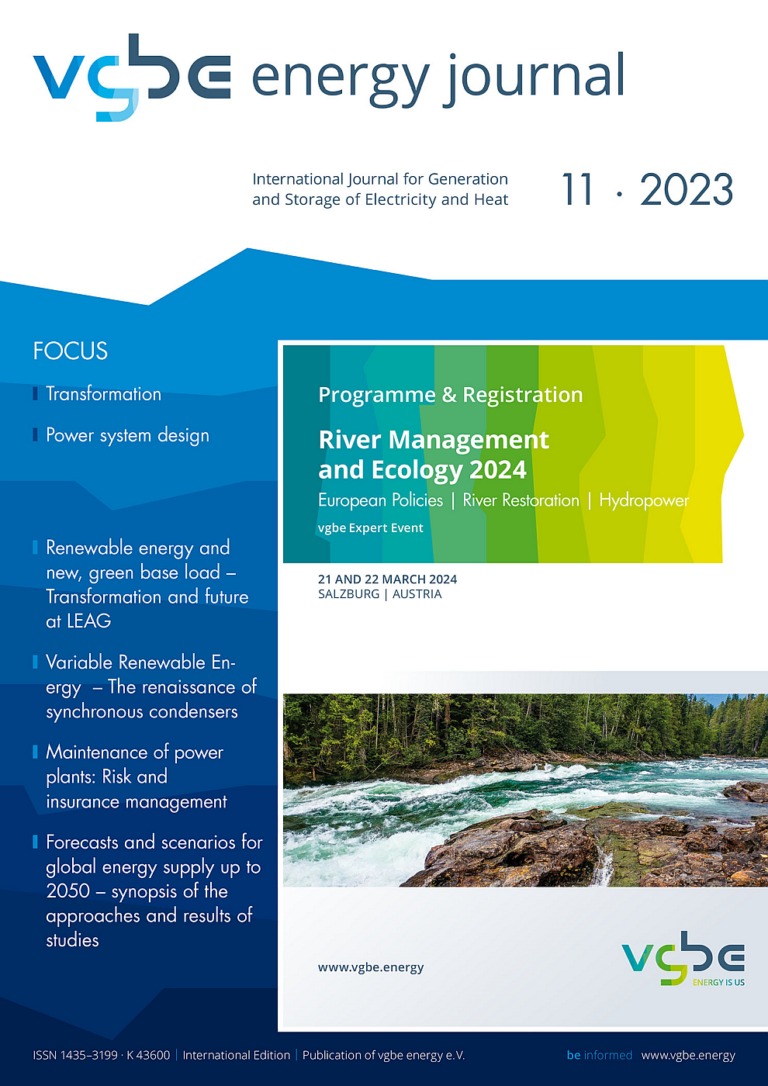Der Wunsch nach Klarheit und Planungssicherheit auf dem Weg zur klimaneutralen Energiezukunft
Dr. Oliver Then
Weihnachten, das Fest der Liebe und des Friedens steht vor der Tür. Liebe zu schenken obliegt nun jeder und jedem Einzelnen von uns, mit dem Frieden sieht es angesichts der zwei fürchterlichen Kriegs- und Krisengebiete vor Europas Haustür leider schlechter bestellt aus. Zumindest ist zu vermerken, dass die Energiebranche im Schulterschluss mit Politik und Gesellschaft in einem großartigen Kraftakt die Energieversorgung Europas im letzten und aller Wahrscheinlichkeit nach auch im anstehenden Winter gesichert hat. Und damit deutlich wurde, was mit vereinten Kräften zu erreichen ist. Und dieser Gedanke führt zum Kern dieses Editorials: Weihnachten, die Zeit der Wünsche.
Aus Sicht unserer Branche bleibt der wichtigste Wunsch seit Jahren der Gleiche: Klarheit und Planungssicherheit durch verlässliche politische Rahmenbedingungen. Auf europäischer Ebene verfolgen uns – oder besser verfolgen wir – die unermüdlichen Regulierungsbemühungen der Kommission: Im Strategischen über den Green Deal und seine wichtigsten Teilprojekte FitFor55 und RePowerEU, im Operativen dann z.B. über die Neuordnung des CO2-Zertifikatehandels oder die Updates der Netzanschlussregeln, der Wasserrahmenrichtlinie oder der Industrieemissionsrichtlinie. Hier arbeitet der vgbe seit vielen Jahren vertrauensvoll und erfolgreich mit unseren Dachverbänden Eurelectric und BDEW zusammen, um den oben genannten Wunsch umzusetzen.
Erneuerbare Energie und neue, grüne Grundlast – Transformation und Zukunft bei LEAG
Philipp Nellessen und Thomas Hörtinger
Von der ostdeutschen Bergbauregion zum außergewöhnlichen Cluster für grüne Energie in Deutschland – diese 180-Grad-Wende wollen wir mit dem Konzept der GigawattFactory in der Lausitz schaffen. Bis 2030 soll sich das traditionsreiche Braunkohlerevier zum größten Zentrum für Erneuerbare Energien in Deutschland wandeln. Die Potentiale dieser Transformation sind so vielschichtig wie einzigartig: eine neue Qualität der nachhaltigen und sicheren Energieversorgung, ein Booster für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und eine Blaupause für den erfolgreichen Wandel von Kohleregionen in aller Welt – diese Chancen bietet die GigawattFactory.
Prognosen und Szenarien für die globale Energieversorgung bis 2050 – Synopse der Ansätze und Ergebnisse von im Jahr 2023 veröffentlichten Studien
Hans-Wilhelm Schiffer
Verschiedene Institutionen veröffentlichen regelmäßig Studien zu den Perspektiven der weltweiten Energieversorgung. Dazu gehören von Regierungen getragene internationale Organisationen, Energieunternehmen, Beratungsunternehmen und wissenschaftliche Institute. Bei den vorgelegten Zukunftspfaden ist zwischen Prognosen und Szenarien zu unterscheiden. Das darin praktizierte unterschiedliche methodische Vorgehen wird skizziert, und es erfolgt eine Kategorisierung der verwendeten Ansätze. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte werden die in den Studien erzielten quantitativen Ergebnisse zur Entwicklung von Primärenergieverbrauch und Stromerzeugung bis 2050 – differenziert nach Energieträgern – dargelegt. Dies geschieht unter Erläuterung bestehender Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In einem Fazit werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich aus den Analysen ableiten lassen – dies vor allem mit Blick auf die Einhaltung der Klimaziele.
Der Einfluss variabler erneuerbarer Energien (VRE) auf die Stabilität des Stromsystems – Die Renaissance der Rotierenden Phasenschieber
Robert Neumann, Gerfried Maier, Serdar Kadam und Werner Ladstätter
Instandhaltung von Kraftwerken: Risiko- und Versicherungsmanagement
Michael Härig
Bei komplexen technischen Anlagen müssen Versicherungen ganz besondere Bedingungen erfüllen, damit im Schadenfall die für die Wiederherstellung notwendige Entschädigung fließen kann. Gleichgültig, ob der Schaden während des Betriebs eingetreten ist oder während der Revision festgestellt wurde oder erst durch die Revision bzw. bei Wiederinbetriebnahme nach einer Revision verursacht wurde.
Der seit einigen Jahren weltweit verhärtete Markt für Industrieversicherungen prägt den Umgang der Versicherer mit diesen Themen. Genauso muss auch die aktuelle Entwicklung in der Energiebranche bei Platzierung der Versicherungen berücksichtigt werden. Mit gezieltem Risiko- und Versicherungsmanagement ist auch heute noch Versicherungsschutz zu wirtschaftlichen Konditionen möglich.
Digitaler Zwilling – vom Prototypen zur fertigen Applikation
Thomas Will und Mojtaba Mahmoodan
Modifikationen und Modernisierungsmaßnahmen an Dampfturbinen in Zeiten des Energiewandels
Stephan Schwab und Tobias Fröse
Die komplexen Anforderungen an Industrie-Dampfturbinen infolge des sich ändernden Energiemarktes erfordern zum effizienten und kundenspezifischen Betrieb Modifikationen und Modernisierungsmaßnahmen. Die Vorgehensweise solcher Modernisierungsmaßnahmen wird im vorliegenden Beitrag anhand von zwei Projektbeispielen erläutert. Beleuchtet werden die Durchführung einer Machbarkeitsstudie, die Bewertung der geplanten Umbaumaßnahmen sowie die abschließende Umsetzung der Modifikationen. Für die Machbarkeitsstudie wird die Dampfturbine bilanziert, die Auslegung der Umbaumaßnahmen und die Modifikationen an der Turbinenregelung sowie die Implementierungen notwendiger Regelungsorgane durchgeführt. Die erforderlichen Daten zur Durchführung dieser Studie sind sehr elementar und geben dem Kunden in kurzer Zeit eine günstige Möglichkeit, nachfolgend die Ergebnisse dieser Studie als Grundlage zur weiteren Prozessbewertung zu verwerten.
Laufzeitverlängerung Dank vorausschauender Instandhaltung
Rudolf Tanner
Die vorausschauende Instandhaltung, engl. Predictive Maintenance (PM), hat in den letzten zwei Jahren massiv an Bedeutung gewonnen, weil die Lieferketten gestört sind. Zur Produktionssicherstellung gibt es verschiedene Optionen, aber jede hat ihren Preis! Alternativ können Anlagenbetreiber Überwachungssysteme einsetzen, welche den Zustand von kritischen Komponenten wie Wälzlager oder Getrieben beurteilen. Dieser Beitrag schlägt ein mögliches Mass für defektbasierte Trendkurven vor und zeigt Praxisbeispiele, die zur Laufzeitverlängerung von rotierenden Maschinen beitrugen.
Optimierungsbasierte vorausschauende Einsatzsteuerung von Erzeugungseinheiten und steuerbaren Verbrauchern
Markus Gölles, Astrid Leitner, Christine Mair, Andreas Moser, Daniel Muschick, Valentin Kaisermayer, Mathias Schwendt und Daria Shabatska
Beschleunigung der Emissionsüberwachung in Kohlekraftwerken in Indien
Lesley Sloss, Sanjeev K Kanchan und Wojciech Jozewicz
Der kohlebefeuerte Energiesektor ist einer der am stärksten Emissionen verursachende Industriesektoren Indiens – kohlebefeuerte Kraftwerke trugen im Jahr 2020 zu 60 % der gesamten Partikelemissionen (PM), 45 % der gesamten SO2-Emissionen, 30 % der gesamten NOx-Emissionen und mehr als 80 % der gesamten Quecksilberemissionen aller Industriesektoren des Landes bei. Als Reaktion auf die anhaltenden Umweltprobleme hat die indische Regierung neue Emissionsgrenzwerte für PM, SO2, NOx und Quecksilber aus Kohlekraftwerken festgelegt. Dieser Bericht soll die Beteiligten bei der Umsetzung der politischen Maßnahmen in Indien unterstützen. Sobald sie über die besten Lösungen sowohl in politischer als auch in technologischer Hinsicht informiert sind, können die Beteiligten echte Kosten-Nutzen-Analysen durchführen und am besten beschreiben, wie ihre Bedürfnisse den Markt für Waren und Dienstleistungen in Indien schaffen.
Editorial

Dr. Oliver Then
Geschäftsführer
vgbe energy, Essen
Der Wunsch nach Klarheit und Planungssicherheit auf dem Weg zur klimaneutralen Energiezukunft
Liebe Leserinnen und Leser des vgbe energy journals, liebe Mitglieder des Verbandes,
Weihnachten, das Fest der Liebe und des Friedens steht vor der Tür. Liebe zu schenken obliegt nun jeder und jedem Einzelnen von uns, mit dem Frieden sieht es angesichts der zwei fürchterlichen Kriegs- und Krisengebiete vor Europas Haustür leider schlechter bestellt aus. Zumindest ist zu vermerken, dass die Energiebranche im Schulterschluss mit Politik und Gesellschaft in einem großartigen Kraftakt die Energieversorgung Europas im letzten und aller Wahrscheinlichkeit nach auch im anstehenden Winter gesichert hat. Und damit deutlich wurde, was mit vereinten Kräften zu erreichen ist. Und dieser Gedanke führt zum Kern dieses Editorials: Weihnachten, die Zeit der Wünsche.
Aus Sicht unserer Branche bleibt der wichtigste Wunsch seit Jahren der Gleiche: Klarheit und Planungssicherheit durch verlässliche politische Rahmenbedingungen. Auf europäischer Ebene verfolgen uns – oder besser verfolgen wir – die unermüdlichen Regulierungsbemühungen der Kommission: Im Strategischen über den Green Deal und seine wichtigsten Teilprojekte FitFor55 und RePowerEU, im Operativen dann z.B. über die Neuordnung des CO2-Zertifikatehandels oder die Updates der Netzanschlussregeln, der Wasserrahmenrichtlinie oder der Industrieemissionsrichtlinie. Hier arbeitet der vgbe seit vielen Jahren vertrauensvoll und erfolgreich mit unseren Dachverbänden Eurelectric und BDEW zusammen, um den oben genannten Wunsch umzusetzen.
Dieser gilt auch für die Dinge, die national zu regeln sind. Seit Monaten wartet die Energiebranche in Deutschland, aber auch in unseren Nachbarländern (aus guten Gründen) sehnsüchtig auf die sogenannte „Kraftwerksstrategie“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Die Erwartungen wurden zuletzt auf dem vgbe Congress im September in Berlin genährt, als Abteilungsleiter Dr. Phillipp Steinberg aus dem BMWK einen Entwurf im Spätherbst in Aussicht stellte. Doch nun, angesichts der Haushaltskrise und der Unsicherheiten rund um den Klima- und Transformationsfonds (KTF), verblasst die Hoffnung auf eine rasche Lösung.
Die Haushaltskrise, ausgelöst durch das Karlsruher Haushaltsurteil, das die Verschiebung von 60 Milliarden Euro in den KTF für verfassungswidrig erklärte, zwingt das Wirtschaftsministerium dazu, das Vorantreiben der Kraftwerksstrategie kurzfristig zu pausieren. Die Klärung relevanter Fragen beim KTF hat nun Vorrang. Trotz dieser Verschiebung betont das Ministerium, dass die Strategie weiterverfolgt wird – ein zartes Signal der Hoffnung für die Energiebranche.
Die Einführung der Kraftwerksstrategie ist von zentraler Bedeutung für den Weg zu einem klimaneutralen Stromsystem. Die geplanten wasserstofffähigen Gaskraftwerke sollen eine Brücke schlagen und erneuerbare Energien ergänzen, insbesondere in Zeiten, in denen Wind und Sonne nicht ausreichend Energie liefern. In Summe werden hierfür neben den anderen Flexibilitätsoptionen im Energiesystem (z.B. Stromimporte, Energiespeicher, Verbrauchssteuerung) zwischen 65 und 120 GW benötigt, je nach Studie. Die Bundesregierung plant deswegen in einem ersten Schritt einen Ausbau von 20 bis 40 GW bis 2030 bzw. 2035, mit Ausschreibungen eigentlich ab 2024. Dies ist jedoch nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern auch eine logistische.
Der Zeitdruck bei den Ausschreibungen für die neuen Gaskraftwerke erhöht sich. Experten aus unseren Mitgliedsunternehmen und auch der Verband selber warnen vor Engpässen beim Bau und betonen die Notwendigkeit, rechtzeitig zu handeln, um die Versorgungssicherheit nach 2030 zu gewährleisten. Für die Realisierung dieser Projekte sind erfahrungsgemäß bis zu 6 Jahre anzusetzen. Ein möglicher Verzug wird außerdem das von der Politik immer noch angestrebte Vorziehen des Kohleausstiegs auf die frühen 2030er Jahre gefährden. Ohne Gaskraftwerke kein Kohleausstieg.
Die Branche benötigt klare Rahmenbedingungen, um nachhaltige Investitionen tätigen zu können. Obwohl neue gasgefeuerte und auf Wasserstoff umrüstbare Gaskraftwerke eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des Stromnetzes spielen und langfristig eben auch Kohlekraftwerke ersetzen sollen, kann ihre Wirtschaftlichkeit aufgrund des bestehenden Marktdesigns nicht gewährleistet werden. Ohne gezielte Förderung wird kein Investor bereit sein, den Bau dieser Back-up-Kraftwerke zu finanzieren. Und dabei ist noch nicht berücksichtigt, ab wann und in welchen Mengen überhaupt grüner Wasserstoff für den Betrieb dieser Anlagen zur Verfügung stehen wird.
Durchaus vielversprechende Modelle zur Förderung wurden bereits vorgestellt, die ohne öffentliche Mittel auskommen. Dabei sollen die Kosten z.B. über die Netzentgelte finanziert werden, indem garantierte Vergütungen zum Zeitpunkt der Investition bereitgestellt werden. Dieser Ansatz könnte Investoren die benötigte Sicherheit bieten und Anreize schaffen, dort zu bauen, wo Kraftwerke am dringendsten gebraucht werden. Allerdings sind hier noch Diskrepanzen zwischen den Vorstellungen der Bundesregierung und den Forderungen der EU zu überwinden.
Die Zeit drängt, und die Energiebranche benötigt klare Signale und Unterstützung von politischer Seite. Die Kraftwerksstrategie darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden, wenn die Energiewende ihre Ziele erreichen soll. Investitionssicherheit, klare Fördermechanismen und eine effiziente Abstimmung mit den europäischen Partnern sind unerlässlich, um die Weichen für eine nachhaltige und klimaneutrale Energiezukunft zu stellen.
Um den Wunschzettel zu Weihnachten abzuschließen, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch im Namen der Belegschaft des vgbe energy e.V. und der vgbe energy service Gmbh ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr.