Forschung für das Energiesystem der Zukunft und Europas Bürger und Wirtschaft
Christopher Weßelmann
Die Energiewende stellt eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit dar. Eine Minderung klimawirksamer Emissionen und der gleichzeitige Ausbau erneuerbarer Energien sind nicht nur notwendig um die globalen Klimaziele zu erreichen, sondern auch, um die Energieversorgungssicherheit Europas langfristig zu gewährleisten. Dabei wird deutlich, dass die Energiewende ohne intensive Forschung und Innovation nicht erfolgreich umgesetzt werden kann. Forschung ist der Schlüssel, um technologische Durchbrüche zu erzielen, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und den europäischen Forschungs- und Wirtschaftsraum raum zu stärken.
Eine der größten Herausforderungen der Energiewende ist die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Energiesysteme. Wind- und Solarenergie sind wetterabhängig und unterliegen starken Schwankungen. Effiziente Energiespeichertechnologien und intelligente Netze sind daher essenziell, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Forschung an Batterietechnologien, Wasserstoff als Energiespeicher und alternativen Ansätzen wie Power-to-X ist von zentraler Bedeutung. Diese Technologien könnten nicht nur den Energiesektor revolutionieren, sondern auch neue Märkte schaffen und Arbeitsplätze in Europa sichern.
Prognosen und Szenarien zur weltweiten Energieversorgung bis 2050 - Synopse zu den Ansätzen und Ergebnissen 2024 veröffentlichter Studien
Hans-Wilhelm Schiffer
Verschiedene Institutionen veröffentlichen regelmäßig Studien zu den Perspektiven der weltweiten Energieversorgung. Dazu gehören von Regierungen getragene internationale Organisationen, Energiekonzerne, Beratungsunternehmen und wissenschaftliche Institute. Bei den vorgelegten Zukunftspfaden ist zwischen Prognosen und Szenarien zu unterscheiden. Das darin praktizierte unterschiedliche methodische Vorgehen wird skizziert, und es erfolgt eine Kategorisierung der verwendeten Ansätze. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte werden die in den Studien erzielten quantitativen Ergebnisse zur Entwicklung von Primärenergieverbrauch und Stromerzeugung bis 2050 – differenziert nach Energieträgern – dargelegt. Dies geschieht unter Erläuterung bestehender Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In einem Fazit werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich aus den Analysen ableiten lassen – dies vor allem mit Blick auf die Einhaltung der Klimaziele.
Windenergie in Lettland – Diskrepanz zwischen Potenzial und Realität
Anna Lankovska, Katarīna Brence, Dzintars Jaunzems und Dagnija Blumberga
Einordnung unterschiedlicher Energiespeicheroptionen im zukünftigen Großhandelsmarkt
Witold Arnold, Sebastian Bohnes und Peter Moser
Neben der direkten Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien werden zunehmend flexible, emissionsneutrale Kapazitäten für die Versorgungssicherheit benötigt. Eine wichtige Säule sind z.B. die im Kraftwerkssicherheitsgesetz vorgesehenen wasserstofffähigen Gaskraftwerke. Zudem wird erwartet, dass auch große Energiespeicherkapazitäten im Rahmen des Energy Shifting eingesetzt werden. Hierfür sind grundsätzlich unterschiedliche Energiespeicheroptionen denkbar, die sich hinsichtlich ihrer technischen und betrieblichen Merkmale unterscheiden. Herkömmliche Vergleichsmethoden, wie z.B. Levelized Cost of Storage (LCOS), vereinfachen die Komplexität des Marktes häufig zu stark und liefern somit eine verzerrte Darstellung der Wirtschaftlichkeit. Der Artikel stellt daher einen erweiterten Bewertungsansatz vor, der technische und betriebliche Parameter einbezieht, um den Betrieb von Energiespeichern genauer zu modellieren. Die Untersuchung zeigt, dass sowohl Wirkungsgrad als auch Speicherkapazität die Wirtschaftlichkeit maßgeblich beeinflussen. Durch die Kombination von Erlös- und Kostenbetrachtungen können bevorzugte Speicherkonfigurationen identifiziert werden. Die vorgestellte Methodik ermöglicht einen fairen, technologieneutralen Vergleich verschiedener Energiespeicheroptionen im Großhandelsmarkt.
Reallabor Großwärmepumpen – Praxisbericht zur Errichtung einer 20 MWth Flusswärmepumpe in Mannheim
Felix Hack und Norbert Wenn
Untersuchungen zur NOx-Reduktion an Erdgasflammen durch zwei verschiedene Flammenkühlerkonstruktionen
Michael Beyer, Thomas Schmidt und Mario Nowitzki
Erfahrungen mit Strukturrohren (ERK tubes) im Überhitzer in einer Müllverbrennungsanlage
Nikolai Sachno, Michael Beyer und Stefan Kohn
Review vgbe-Chemiekonferenz 2024
vgbe energy
Die traditionsreiche vgbe-Chemiekonferenz fand in diesem Jahr bereits zum 60. Mal statt. Dazu sind rund 160 Teilnehmende aus dem In- und Ausland vom 22. bis 24. Oktober 2024 nach Potsdam gekommen, um sich über die aktuellen Trends und Herausforderungen der Kraftwerkschemie auszutauschen und zu informieren.
56. Kraftwerkstechnisches Kolloquium
Sandra Leik
Editorial
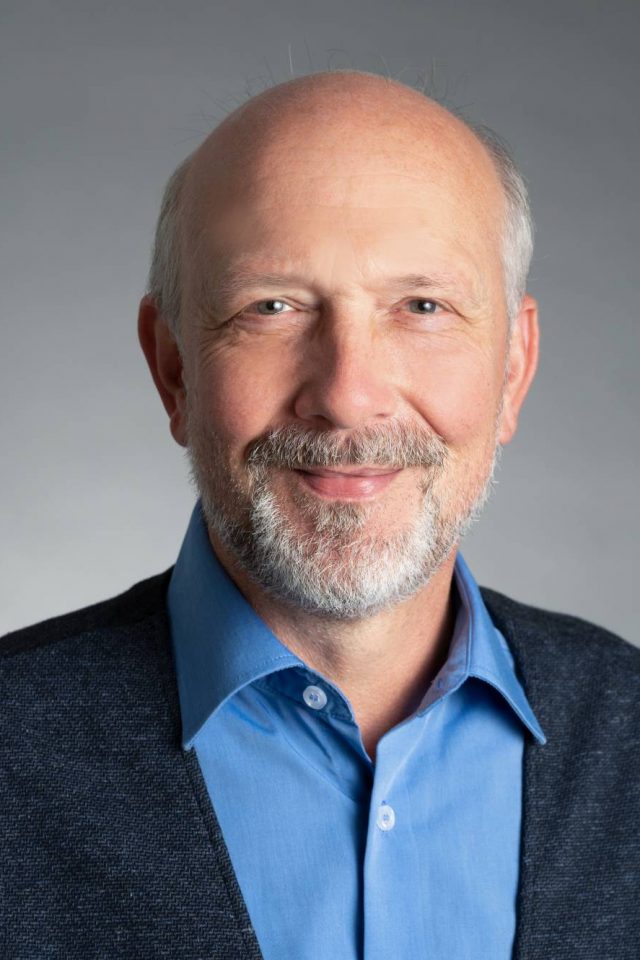
Christopher Weßelmann
Chefredakteur vgbe energy
Forschung für das Energiesystem der Zukunft und Europas Bürger und Wirtschaft
Liebe Leserinnen und Leser,
Die Energiewende stellt eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit dar. Eine Minderung klimawirksamer Emissionen und der gleichzeitige Ausbau erneuerbarer Energien sind nicht nur notwendig um die globalen Klimaziele zu erreichen, sondern auch, um die Energieversorgungssicherheit Europas langfristig zu gewährleisten. Dabei wird deutlich, dass die Energiewende ohne intensive Forschung und Innovation nicht erfolgreich umgesetzt werden kann. Forschung ist der Schlüssel, um technologische Durchbrüche zu erzielen, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und den europäischen Forschungs- und Wirtschaftsraum zu stärken.
Eine der größten Herausforderungen der Energiewende ist die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Energiesysteme. Wind- und Solarenergie sind wetterabhängig und unterliegen starken Schwankungen. Effiziente Energiespeichertechnologien und intelligente Netze sind daher essenziell, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Forschung an Batterietechnologien, Wasserstoff als Energiespeicher und alternativen Ansätzen wie Power-to-X ist von zentraler Bedeutung. Diese Technologien könnten nicht nur den Energiesektor revolutionieren, sondern auch neue Märkte schaffen und Arbeitsplätze in Europa sichern.
Der europäische Forschungsraum spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch grenzüberschreitende Kooperationen können Synergien genutzt und Innovationen beschleunigt werden. Programme wie Horizon Europe unterstützen Forschungsprojekte, die darauf abzielen, die Energiewende voranzutreiben. Europa hat das Potenzial, durch Forschung und Entwicklung eine globale Vorreiterrolle in der Energietechnik einzunehmen. Die enge Zusammenarbeit von Universitäten, Forschungseinrichtungen und der Industrie ist dabei der Schlüssel, um die Energieversorgung nachhaltig und wettbewerbsfähig zu gestalten.
Darüber hinaus ist die Forschung nicht nur eine Frage der technischen Machbarkeit, sondern auch der wirtschaftlichen und sozialen Akzeptanz. Neue Technologien müssen kosteneffizient und für die breite Bevölkerung zugänglich sein. Nur so kann die Energiewende zu einem gesellschaftlichen Erfolg werden. Forschungseinrichtungen in Europa tragen durch innovative Ansätze und interdisziplinäre Zusammenarbeit dazu bei, diese Ziele zu erreichen. Neben technischen Aspekten gewinnen auch sozialwissenschaftliche Studien an Bedeutung, um die Akzeptanz neuer Technologien zu untersuchen und Strategien für deren erfolgreiche Implementierung zu entwickeln.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Energiewende für Europa ist nicht zu unterschätzen. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung können europäische Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und eine Vorreiterrolle in neuen Technologiemärkten einnehmen. Insbesondere die Entwicklung von Spitzentechnologien wie innovativen Windturbinen, effizienteren Photovoltaikanlagen oder CO2-Abscheidungs- und Speichertechnologien bietet enorme wirtschaftliche Chancen. Diese Innovationen schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern stärken auch die Position Europas im globalen Wettbewerb.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Energiewende ist die Dekarbonisierung der Industrie. Viele energieintensive Branchen, wie die Stahl- und Chemieindustrie, stehen vor der Aufgabe, ihre Prozesse grundlegend zu ändern, um klimaneutral zu werden. Auch hier spielt die Forschung eine tragende Rolle. Pilotprojekte und neue Technologien, wie die Nutzung von grünem Wasserstoff in der Stahlerzeugung, sind vielversprechende Ansätze, um die Industrie nachhaltiger zu gestalten.
Die Energiewende erfordert zudem eine Neugestaltung der Infrastruktur. Der Ausbau von Stromnetzen, die Entwicklung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und die Schaffung von Speicheranlagen sind essenzielle Bausteine, um die Transformation erfolgreich zu gestalten. Forschung und Innovation sind hier die Triebfedern, um zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und bestehende Technologien weiter zu optimieren.
Doch Forschung braucht auch Zeit, Ressourcen und eine klare politische Unterstützung. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind Investitionen in die Zukunft. Nur durch eine konsequente Förderung können die notwendigen Innovationen erzielt werden, um die Energiewende voranzutreiben. Dabei ist es wichtig, dass politische Entscheidungsträger den Mut haben, langfristig zu denken und Rahmenbedingungen zu schaffen, die Forschung und Innovation begünstigen.
