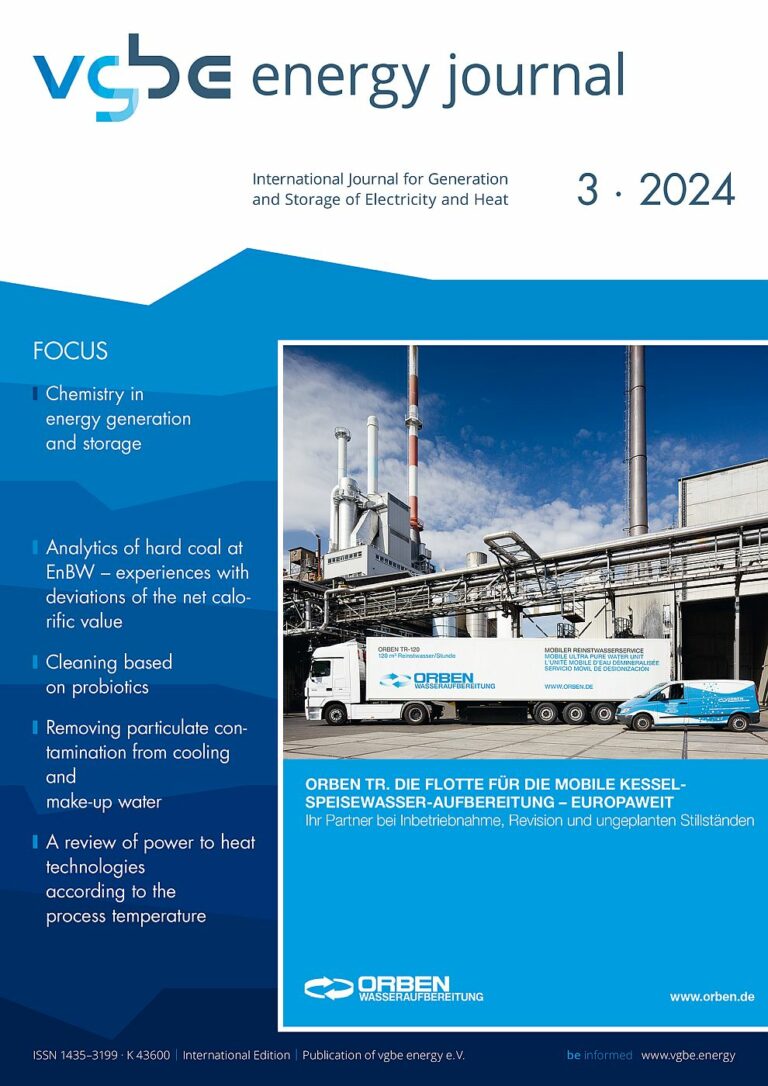Aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Kraftwerkschemie
Dr.rer.nat. Anne Wiesel
Die Energiewelt ist im Wandel. Dies hat über die Pläne zu Veränderungen in den Kraftwerken auch einen Einfluss auf die Herausforderungen der Kraftwerkschemie. Sowohl in den verschiedenen vgbe-Gremien als auch bei der vgbe-Chemiekonferenz ist es spürbar, dass sich die Themen, die im Fokus sind, verändern.
In den letzten paar Jahren ergaben sich einige wichtige Änderungen in den konventionellen Kraftwerken, wie beispielsweise die Absenkung von Rauchgas- und Abwassergrenzwerten, die die Kraftwerkschemiker immer noch begleiten und die ständig zu neuen Aufgabenstellungen führen. Neben den Grenzwerten an sich müssen auch Bestimmungsgrenzen der Messmethoden teilweise abgesenkt werden, um die Einhaltung der Grenzwerte noch nachweisen zu können. Auch die bestehenden Kraftwerksblöcke müssen stetig optimiert werden: Die Nachrüstung von Onlinemessgeräten muss betrachtet werden, da die Laborbesetzung in der Regel heute kleiner ist als bei dem Bau der Kraftwerksblöcke und dadurch an manchen Stellen Labormessungen nur noch in größeren zeitlichen Intervallen möglich sind. Wasseraufbereitungsanlagen sind oft schon in die Jahre gekommen, wodurch sich ein höherer Betreuungsaufwand und Optimierungsbedarf ergibt.
Analytik von Steinkohle bei EnBW – Erfahrungen mit Abweichungen im Heizwert
Anne Wiesel
Reinigung durch Probiotika
Bianca Spindler und Kerstin Keppler
Aufgrund einer Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung durch in Aerosolen enthaltene Legionellen, ist nur der hygienegerechte Betrieb von Rückkühlwerken/Kühltürmen und Nassabscheidern erlaubt. Dies führt dazu, dass in den dazu verwendeten Kühlwässern/ Nutzwässern in der Europäischen Union jährlich 50.000 Tonnen Biozide eingesetzt werden. Um die Mikrobiologie eines wässrigen Systems zu verstehen, muss man die Wasserphase, aber auch die oberflächlichen Beläge und Biofilme bewerten. Probiotika können Systeme auf natürliche Art und Weise reinigen indem sie diese Biofilme verstoffwechseln und sich dazu auf den Oberflächen ansiedeln. Durch die Reinigung verlieren Mikroorganismen, die eng mit Biofilmen verbunden sind, oftmals die Lebensgrundlage. Mittelfristig verbessert sich dadurch nachhaltig und umweltfreundlich die Systemsauberkeit und Hygiene. In einem sauberen System kommt es zu weniger zu mikrobiell bedingten Problemen.
Beseitigung partikulärer Verunreinigungen aus Kühl- und Zusatzwasser
Friedrich Wilhelm
Einsatz von Ferndiagnosesystemen auf der Grundlage einer virtuellen Umgebung und digitaler Zwillinge zur Bewertung der Lebensdauer von Energieanlagen
Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski und Radosław Stanek
Eine Übersicht zu Kraft-Wärme-Kopplungs-Technologien in Abhängigkeit von der zu erreichenden Prozesstemperatur im Bereich von 40 °C bis über 1500 °C & Technologiewirkungsgrade
Torsten Buddenberg, Sven Bosser und Emmanouil Kakaras
Im Rahmen der Energiewende wird die Elektrifizierung von Prozessen an Bedeutung gewinnen, um indirekte und direkte Treibhausgasemissionen der fossilen Brennstoffeg zu vermeiden. Je höher die Prozesstemperatur ist, desto schwieriger ist diese Elektrifizierung. Ein Querschnitt der Technologien wird mit ihren erreichbaren Leistungszahlen und ihren erreichbaren Temperaturen diskutiert und eingeordnet. Dies wird mit dem Einsatz von Brennstoffersatz durch Wasserstoff oder Biogas verglichen und auf den Wärmeverbrauch in Deutschland hochgerechnet. Ebenso wird Power-to-Heat-to Power diskutiert.
Betriebserfahrungen mit dem Prototyp der Gasturbine MGT8000 im Heizkraftwerk 2, Oberhausen der evo
Christian Steinbach, Philipp Fockenberg, Karim Saidi, Stephan Dors,Oliver Keil und Sebastian Mombeck
Additive zur SOX-Abscheidung, Belagsund Korrosionsmanagement im Kessel von WtE-Anlagen
Martin Sindram, Diethelm Walter und Frank Hernitschek
Der Einsatz kalk- und dolomitstämmiger Additive – in vorhandenen Stufen oder als Zusatzmaßnahme – wird behandelt. Der Fokus liegt hier auf dem Einsatz dieser Additive im Feuerraum oder im Kessel von Waste-to-Energy (WtE)-Anlagen. Die Verwendung von Kalkprodukten zur Entschwefelung der Rauchgase im Kessel hat eine lange Tradition und ist unter den Begriffen Direktentschwefelung oder Hochtemperatur-Trocken- Additiv-Verfahren (HT-TAV) bekannt. In einer Vielzahl dieser Anlagen muss dabei neben HCl auch vermehrt SO2 abgeschieden werden. In diesem Beitrag wird über aktuelle Beispiele aus der Praxis berichtet. Möglichkeiten zur Nachrüstung bestehender Anlagen und Konzepte für Neuanlagen werden vorgestellt und Leistungsdaten unter besonderer Berücksichtigung verschärfter Grenzwerte herausgearbeitet. Die verwendeten Betriebsmittel werden hinsichtlich ihrer Anwendung und Eignung behandelt.
Das Potenzial der Kohlenstoffnutzung in einer Netto-Null-Emissionswirtschaft
Qian Zhu
Eurelectric-Positionspapier zur Governance der Energieunion und zu Klimaschutzmaßnahmen
eurelectric
vgbe Fachtagung „Thermische Abfall-/ Klärschlammbehandlung und Wirbelschichtfeuerungen 2023“
vgbe energy e.V.
Editorial

Dr.rer.nat. Anne Wiesel
Leiterin Produktionsservice
EnBW Energie Baden-Württemberg AG,
Altbach
Vorsitzende vgbe Technical Committee Chemie & Emissionsminderung
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Kraftwerkschemie
Liebe Leserinnen und Leser des vgbe energy journals,
die Energiewelt ist im Wandel. Dies hat über die Pläne zu Veränderungen in den Kraftwerken auch einen Einfluss auf die Herausforderungen der Kraftwerkschemie. Sowohl in den verschiedenen vgbe-Gremien als auch bei der vgbe-Chemiekonferenz ist es spürbar, dass sich die Themen, die im Fokus sind, verändern.
In den letzten paar Jahren ergaben sich einige wichtige Änderungen in den konventionellen Kraftwerken, wie beispielsweise die Absenkung von Rauchgas- und Abwassergrenzwerten, die die Kraftwerkschemiker immer noch begleiten und die ständig zu neuen Aufgabenstellungen führen. Neben den Grenzwerten an sich müssen auch Bestimmungsgrenzen der Messmethoden teilweise abgesenkt werden, um die Einhaltung der Grenzwerte noch nachweisen zu können. Auch die bestehenden Kraftwerksblöcke müssen stetig optimiert werden: Die Nachrüstung von Onlinemessgeräten muss betrachtet werden, da die Laborbesetzung in der Regel heute kleiner ist als bei dem Bau der Kraftwerksblöcke und dadurch an manchen Stellen Labormessungen nur noch in größeren zeitlichen Intervallen möglich sind. Wasseraufbereitungsanlagen sind oft schon in die Jahre gekommen, wodurch sich ein höherer Betreuungsaufwand und Optimierungsbedarf ergibt. Trotz bewegter Zeiten ist die Einhaltung der geforderten Speise-, Kesselwasser- und Dampfreinheit im Wasser-Dampf-Kreislauf gemäß VGBE-S-010-00-2023-08 weiterhin essenziell, um kostspielige Schäden an der Turbine und im Kessel zu vermeiden. Die Herausforderungen für die Anlagenteile werden umso größer, da wir heute mit ständigen An- und Abfahrten in unberechenbaren Abständen umzugehen haben. Der genannte vgbe-Standard wurde auch kürzlich revisioniert, um aktuelle Aspekte einfließen zu lassen.
Vor allem im Winter 2022/2023 führten die Lieferschwierigkeiten von Chemikalien zu einem Mehraufwand für die Kraftwerkschemiker. Neben dem Einsatz von mobilen Umkehrosmoseanlagen in der Wasseraufbereitung, um Regenerierchemikalien für die Ionenaustauscheranlagen zu sparen, waren auch Ersatzstoffe (z.B. für Flockungsmittel) sowie angebotene reduzierte Qualitäten von Hilfsstoffen zu bewerten. Diesbezüglich hatte man sich auch auf den Winter 2023/2024 vorbereitet, jedoch waren die Maßnahmen hier nicht zum Tragen gekommen.
Neue Arbeitsgebiete, mit denen man sich in den vgbe-Gremien beschäftigt, resultieren vor allem aus den „Fuel Switch“-Projekten und weiteren Anlagenneubauten im Zuge der CO2-Minderungsmaßnahmen. So ist die Biomasseverbrennung und deren Einfluss auf die Verschlackung und Rauchgasreinigung zu betrachten, insbesondere die Herausforderung bei einem Wechsel auf 100 % Biomasse. Andere neue Projekte beinhalten die Planung von „Carbon Capture and Storage“ (CCS) – Anlagen, bei denen noch viel Erfahrung zu sammeln ist. Der geplante „Fuel Switch“ von Kohle zu Erdgas zu Wasserstoff, sowohl in Bestandsanlagen als auch Neubauten, wirft noch zahlreiche Fragen auf, die von Kraftwerkschemikern zu durchdenken sind. Großwärmepumpen, Geothermie und Elektrolyse sind weitere Erzeugungsarten, die in den vgbe-Gremien verstärkt in den Fokus rücken. Bei manchen Themen stehen wir teilweise noch am Anfang, alle wichtigen Fragestellungen zu definieren und die geeigneten Knowhow-Träger zur Erarbeitung neuer vgbe-Standards zu gewinnen.
Auf der vgbe-Chemiekonferenz im Oktober 2023 in Ingolstadt hat Michael Rziha (PPChem AG) in seinem Eröffnungsvortrag eindrucksvoll den Knowhow-Verlust in der Kraftwerkschemie beklagt. Hier sind wir alle aufgerufen, das Wissen der Kraftwerkschemie wertzuschätzen und frühzeitig für eine geeignete Nachfolge zu sorgen. Die Kenntnisse können hier nur durch eine ausreichende Einarbeitung und jahrelange Erfahrung erworben werden. Es muss weiterhin bedacht werden, warum die Kraftwerkschemie ursprünglich aufgebaut wurde – um teure Schäden an den Anlagen, beispielsweise durch Korrosion, zu vermeiden. Der Schutz des Wasser-Dampf-Kreislaufs und somit der Dampfturbine ist ein wichtiges Ziel auch bei den Neuanlagen, insbesondere wenn wir hier eine hohe Verfügbarkeit erreichen wollen.
Helfen Sie also mit, uns im vgbe zu vernetzen, damit wir uns mit Knowhow ergänzen und die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen!