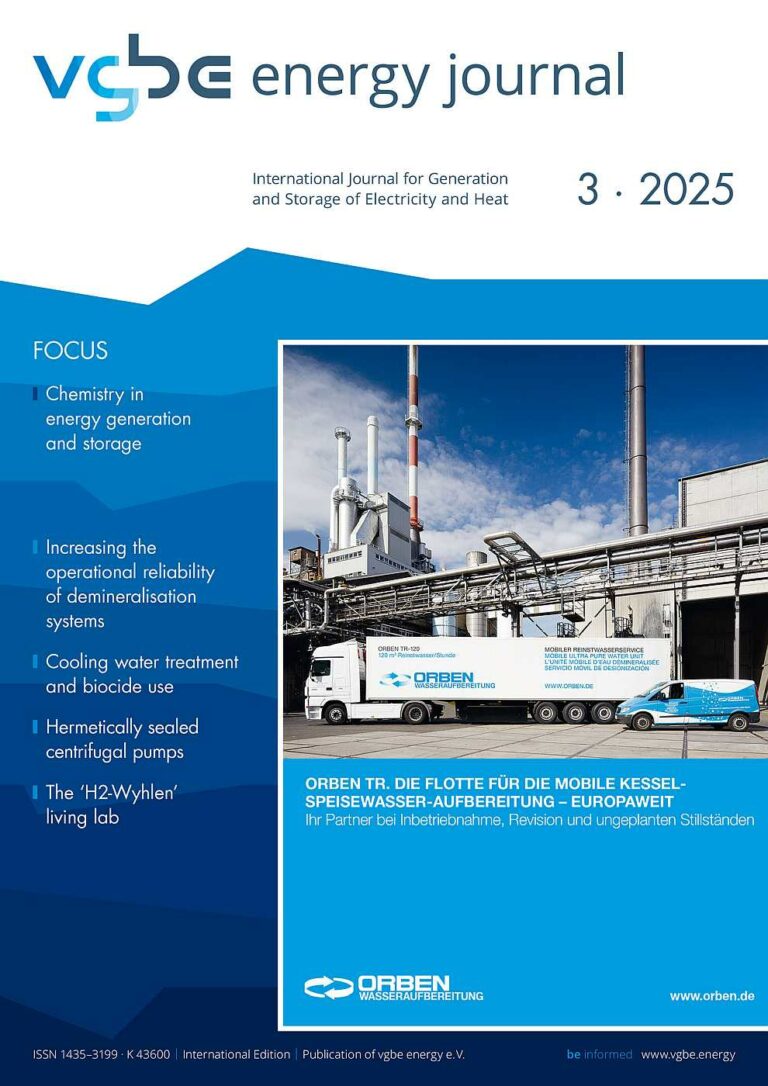Herausforderungen der Kraftwerkschemie durch die Energie- und Wärmewende
Heiko Woizick
Die immer schneller voranschreitende Energie- und Wärmewende hat große Auswirkungen auf die Kraftwerkschemie. Während durch die Abschaltung von immer mehr Stein- und Braunkohlekraftwerksblöcken die Analysen für Brennstoffe, Aschen und den klassischen Kraftwerksnebenprodukten zurückgehen, kommen durch neue Technologien auch neue Herausforderungen auf die Kraftwerkschemie zu.
Die auch langfristig weiterhin notwendigen Gaskraftwerke und GuD-Anlagen werden immer flexibler eingesetzt. Deshalb muss die Überwachung, Konditionierung und Konservierung der Wasser-Dampfkreisläufe von GuD-Anlagen angepasst werden. Wie kann die Dampfreinheit bei Anlagenstart schneller erreicht und auch sicher gemessen werden? Muss die stärkere Materialbelastung durch die höheren Lastgradienten bei der Konditionierung vom Wasser-Dampfkreislauf berücksichtigt werden? Wie werden die Anlagen konserviert, wenn man beim Abfahren nicht genau weiß, wie lange sie stillstehen wird – aber eine ständige kurzfristige Startbereitschaft gegeben sein muss?
Erhöhung der Betriebssicherheit von VE-Anlagen mit Hilfe von Korrelationsdiagrammen – Die neue Sprache von VE-Straßen
Dieter Mauer
Die VE-Straße spricht ihre eigene Sprache, welche sich über Korrelationsdiagramme sehr gut verstehen lässt. Das sind X/Y-Darstellungen von pH und Leitfähigkeit in einem Diagramm. Im Beitrag wird die Frage geklärt, was die Na+OH–-Linie ist, was die H+HCO3–-Linie ist und warum es im Diagramm verbotene Bereiche gibt. Ebenso wird beschrieben, wie die immer wichtiger werdenden pH-Messungen weitestgehend ohne Wartungsaufwand betrieben werden können. Der Nutzwert geht aber noch über die reine Interpretation des Anlagenverhaltens hinaus. Es besteht z.B. die Möglichkeit einer Auto-Kalibration von pH-Messungen per SW – auf wenige Hundertstel pH genau! Das schafft keine Kalibration per Pufferlösung und vor allem nicht über viele Monate oder sogar länger.
Wenn es hoch hergeht im Fördermedium: hermetisch dichte Kreiselpumpen
Jens-Christian Poppe
Kühlwasserkonditionierung und Biozideinsatz
Holger Ohme
Die chemische Behandlung von Kühlwasser zielt darauf ab, Ablagerungen zu verhindern und den Korrosionsschutz zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf der Kontrolle der mikrobiologischen Aktivität liegt. Moderne Wasseraufbereitungstechniken basieren auf einer bedarfsgerechten Dosierung von Chemikalien und Bioziden durch Überwachung und Automatisierung. Kritische Ablagerungen, insbesondere Biofilme, werden durch mikrobiologisches Wachstum verursacht und sind für über 30 % der Korrosionsschäden verantwortlich. Die Verwendung von Phosphonaten als Härtestabilisatoren erfordert Formulierungen, die gegenüber Oxidationsmitteln stabil sind, während die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Dispergiermitteln steigt. Darüber hinaus stellt die Verschmutzung durch Muscheln, insbesondere die Quagga-Muschel, eine Herausforderung für Kühlsysteme dar. Bei der Auswahl oxidierender Biozide müssen Verbrauchsfaktoren berücksichtigt werden, da verschiedene Substanzen die Wirksamkeit beeinflussen können. Monochloramin bietet eine wirtschaftliche Alternative zu anderen Bioziden, da es selektiv wirkt und weniger Nebenreaktionen aufweist. Technologische Fortschritte ermöglichen eine präzise Steuerung von Bioziden und Inhibitoren durch wartungsfreie Sensoren und bildgebende Verfahren.
Reallabor „H2-Wyhlen“ – Herausforderungen und Chancen bei der Errichtung und dem Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen am Beispiel eines Demonstrationsprojekts
Reihaneh Zohourian, Hepke Kruse, Vassilios Vrangos und Prof. Wolfram Münch
Wohlstand und Wachstum – Was müssen wir verändern?
Franz Josef Radermacher
Die Welt befindet sich in großen Schwierigkeiten. Der wachsende Konflikt zwischen den USA und China zerreißt die bisherige regelbasierte Ordnung. Zwischenzeitlich sehen wir eine neue „Lagerbildung“ in der Staatenwelt. Wir leben in einer kulturellen Krise und erleben weltweit kulturelle Konflikte. Bei den für die Zukunft besonders wichtigen Themen Energie und Klima geht es nicht wirklich weiter. In diesem Bereich, der unbedingt eine globale Betrachtung und ein entsprechendes Handeln erfordert, herrscht bei uns ein strikter Fokus auf nationale, bestenfalls europäische Ansätze. Es scheint den Akteuren mehr um Befindlichkeiten und Wählerstimmen zu gehen, als um die Lösung eines zentralen globalen Problems.
Die Rolle von Biomasse bei der Produktion von Eisen, Stahl und Zement
Jenny Jones, Leilani Darvell und Bijal Gudka
DNV: Deutschland auf gutem Weg zur Energie-Unabhängigkeit – Klimaziel wird knapp verpasst
DNV
Data: IEA – Electricity 2025
International Energy Agency (IEA)
Die stark wachsende Stromnachfrage läutet ein neues Zeitalter der Elektrizität ein, in dem der Verbrauch bis 2027 in die Höhe schnellen wird. Die Elektrifizierung von Gebäuden, Verkehr und Industrie in Kombination mit einer wachsenden Nachfrage nach Klimaanlagen und Rechenzentren leitet den Wandel hin zu einer globalen Wirtschaft ein, deren Fundament Elektrizität ist. Die Internationale Energieagentur (IEA) bietet mit ihrem Bericht „Electricity 2025“ eine tiefgreifende und umfassende Analyse all dieser Trends sowie der jüngsten politischen Entwicklungen. Für den Zeitraum 2025 bis 2027 prognostiziert sie die Stromnachfrage, das Stromangebot und die Kohlendioxid (CO2)-Emissionen für ausgewählte Länder, nach Regionen und weltweit. Der Bericht untersucht aufkommende Trends wie die zunehmende Elektrifizierung, den Ausbau von Stromsystemen und einen steigenden Anteil wetterabhängiger Energiequellen im Erzeugungsmix.
Ausgeglichene Marktbedingungen führen bei Gaspreisen in 2025–2026 zu moderaten Schwankungen
GEFC Gas Exporting Countries Forum
Die Höhe der Gaspreise ist ein entscheidender Faktor für die Gasnachfrage und die Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas im Vergleich zu anderen Energiequellen. Wenn die Gaspreise niedriger sind als die Paritätspreise von Alternativen wie Kohle, Öl oder erneuerbaren Energien, wird Erdgas für Verbraucher attraktiver, was zu einer höheren Nachfrage führt. Wenn die Gaspreise jedoch deutlich steigen, könnten Verbraucher auf kostengünstigere Alternativen umsteigen und so den Marktanteil von Erdgas verringern. 2024 war eine Phase der Stabilisierung der Spotgaspreise, die in starkem Kontrast zu der extremen Volatilität der letzten vier Jahre stand, in denen sowohl Rekordtiefs als auch Rekordhöhen zu verzeichnen waren. Für 2025 wird ein Anstieg der weltweiten Spotgaspreise erwartet, der auf das anhaltende Wachstum der weltweiten Gasnachfrage, das auf 2 % geschätzt wird, und die positiven Wirtschaftsaussichten mit einem prognostizierten globalen BIP-Wachstum von über 3 % zurückzuführen ist. Im Jahr 2026 wird erwartet, dass sich der Markt entspannt, da die 2025 in Betrieb genommenen LNG-Verflüssigungsprojekte die Produktion hochfahren und eine zusätzliche Kapazität von 57 Mtpa ans Netz geht.
Editorial

Heiko Woizick
Leiter Kraftwerkschemie
RheinEnergie AG, Köln
Vorsitzender vgbe Technical Committee Chemische Verfahrenstechnik und Analytik
Herausforderungen der Kraftwerkschemie durch die Energie- und Wärmewende
Liebe Leserinnen und Leser,
die immer schneller voranschreitende Energie- und Wärmewende hat große Auswirkungen auf die Kraftwerkschemie. Während durch die Abschaltung von immer mehr Stein- und Braunkohlekraftwerksblöcken die Analysen für Brennstoffe, Aschen und den klassischen Kraftwerksnebenprodukten zurückgehen, kommen durch neue Technologien auch neue Herausforderungen auf die Kraftwerkschemie zu.
Die auch langfristig weiterhin notwendigen Gaskraftwerke und GuD-Anlagen werden immer flexibler eingesetzt. Deshalb muss die Überwachung, Konditionierung und Konservierung der Wasser-Dampfkreisläufe von GuD-Anlagen angepasst werden. Wie kann die Dampfreinheit bei Anlagenstart schneller erreicht und auch sicher gemessen werden? Muss die stärkere Materialbelastung durch die höheren Lastgradienten bei der Konditionierung vom Wasser-Dampfkreislauf berücksichtigt werden? Wie werden die Anlagen konserviert, wenn man beim Abfahren nicht genau weiß, wie lange sie stillstehen wird – aber eine ständige kurzfristige Startbereitschaft gegeben sein muss?
Die Gaskraftwerke sollen zukünftig zunehmend mit Wasserstoff betrieben werden, was neue Anforderungen an die verwendeten Materialien mit sich bringt. Die Chemische Industrie arbeitet schon seit Jahrzehnten mit Wasserstoff. Das dort bestehende Wissen zum Umgang mit Wasserstoff sollte beim Aufbau der Wasserstoffnetze und in der Kraftwerkstechnik genutzt werden. Dabei muss man genau prüfen, was für die Kraftwerkstechnik angepasst werden muss.
Der Wasserstoff für die neuen Netze muss auch klimaneutral produziert werden. Weltweit werden immer größere Elektrolyseanlagen geplant und die ersten auch gebaut, wenige sind bereits in Betrieb. Dabei werden überwiegend die drei Verfahren Alkalische Elektrolyse (AEL), die Proton-Exchange-Membran-Elektrolyse (PEM) und die Hochtemperatur-Elektrolyse mit SOE-Stacks (Solid Oxide Electrolysis) eingesetzt. Diese Elektrolyseverfahren haben unterschiedliche Anforderungen an die Reinheit des Wassers. Diese gehen zum Teil wesentlich über die Anforderungen an das Vollentsalzte Wasser für den Kraftwerksbetrieb hinaus. Deshalb wird das Merkblatt VGB-M 407 (Konzeption, Spezifizierung und Leistungsnachweis von Anlagen zur Wasserentsalzung) gerade überarbeitet und erweitert. Es soll darin auch Hinweise zum Materialeinsatz im Kontakt mit diesem hochreinen VE-Wasser geben. Verschiedene Betriebserfahrungen zeigen nämlich, dass es Untersuchungsbedarf gibt, sei es durch Korrosion oder Abgabe unerwünschter Stoffe. Die Erfahrungen der ersten Betreiber sind in diesem Punkt besonders wichtig.
Im Rahmen der Wärmewende werden an vielen Kraftwerksstandorten zurzeit Großwärmepumpen installiert. Dort werden zum Teil Wärmeübertrager aus Kupfer mit Kontakt zum Fernwärmewasser eingesetzt, ohne dass geklärt ist, ob das Kupfer langfristig beständig ist oder ob das in Spuren in das Fernwärmewasser abgegebene Kupfer im Fernwärmenetz zu Korrosion führt. Es ist zu diskutieren und prüfen, ob die etwas teureren und größeren Wärmeübertrager aus nichtrostendem Stahl nicht langfristig die bessere Wahl sind.
Bei vielen Betreibern werden gerade Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen für die ab 2029 vorgeschriebene Rückgewinnung des Phosphors im Klärschlamm geplant und gebaut. Die ersten Anlagen sind schon in Betrieb und stellen die Kraftwerkschemie vor neue Herausforderungen. Das anfallende Brüdenkondensat wird meist noch teuer entsorgt. Die Aufbereitung als Alternative erfordert einen sehr hohen Aufwand und bereitet noch große Probleme im Betrieb. Bei neuen Anlagen werden auch perspektivisch niedrigere Grenzwerte für Quecksilber im Rauchgas und Abwasser berücksichtigt und Rauchgasreinigungen mit Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA) wie in den großen Stein- und Braunkohleanlagen geplant, bloß ungefähr eine Größenordnung kleiner. Dort kann die Erfahrung aus den Kohle-Großkraftwerken, die in absehbarer Zeit abgeschaltet werden, weiter genutzt werden.
Dies alles passiert in einer Zeit, in der mit der Abschaltung der Kohlekraftwerke auch viele Kraftwerkslabore geschlossen und die mit der Chemie vertrauten Beschäftigten oft frühzeitig in den Ruhestand geschickt werden. Deren Expertenwissen fehlt dann.