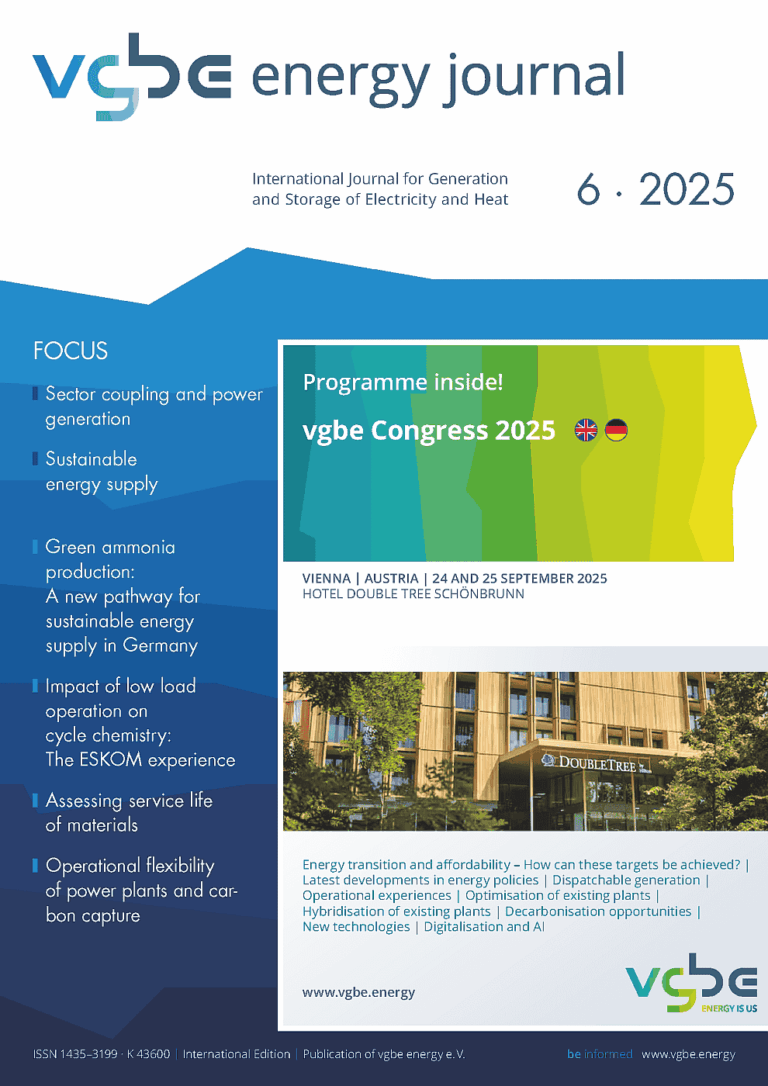Mehr als Aufwind – Windenergie im digitalen Wandel
Stefan Bogenberger und Dr. Mario Bachhiesl
Die Windenergiebranche steht vor einem technologischen Umbruch. Bereits heute deckt Windstrom knapp ein Drittel des Stromverbrauchs in Deutschland und rund 19 % in der EU . Deutschland war 2024 führend beim Ausbau der Windkraft in Europa: Über 4 GW neue Leistung wurden installiert – davon entfielen rund 3,3 GW (82 %) auf Onshore-Anlagen1. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten Repowering-Projekte mit einer installierten Leistung von 1,1 GW. Gleichzeitig wurden 557 Windenergieanlagen an Land mit insgesamt 712 MW stillgelegt, was zu einem Netto-Zubau von rund 2,6 GW im Onshore-Segment führte2. Europaweit sind mittlerweile rund 285 GW Windleistung installiert – 248 GW Onshore und 37 GW Offshore.
Diese Dynamik erfordert neue Lösungen, um Betrieb und Netzintegration effizient zu gestalten. Trotz Herausforderungen etwa bei Genehmigungen und Netzausbau zeigen zahlreiche Entwicklungen, wie Digitalisierung, innovative Betriebsführung und verstärkte Systemdienlichkeit die Windenergie auf die nächste Stufe heben.
Grüne Ammoniakproduktion: Ein neuer Weg für eine nachhaltige Energieversorgung in Deutschland
Amin Soleimani Mehr, Günter Scheffknecht, Reihaneh Zohourian und Jörg Maier
Um eine kostengünstige und zuverlässige Energieversorgung in Deutschland mittel- und langfristig sicherzustellen, muss grüner Wasserstoff in erheblichem Umfang aus Ländern mit niedrigen Produktionskosten importiert werden. Angesichts der erheblichen Hindernisse beim Transport von Wasserstoff bietet grüner Ammoniak jedoch eine Lösung und einen Hoffnungsschimmer. Dank seiner Energie- und Raumeffizienz beim Transport sowie seiner weltweit etablierten Transportinfrastruktur kann es als Wasserstoffträger und Transportkraftstoff dienen und damit die Energiebranche revolutionieren. Diese Studie ist von größter Bedeutung, da sie eine umfassende techno-ökonomische Analyse der Produktion von grünem Ammoniak in verschiedenen Kapazitäten durchführt.
Auswirkungen des Betriebs mit geringer Last auf die Zykluschemie: Die Erfahrungen und Perspektiven von Eskom in zwei Kohlekraftwerken
Zanele Dladla und Dheneshree Lalla
Eskom plant die Integration erneuerbarer Energiequellen in sein Stromversorgungsnetz, das derzeit unter schwankenden Angebots- und Nachfrageschwankungen leidet. Unter diesen Umständen ist es für Eskom strategisch notwendig, aus Sicht der Produktionsplanung und des Anlagenmanagements der Kraftwerksflotte systematisch zu prüfen, welche Schritte erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die bestehende Kohleflotte über ausreichende betriebliche Flexibilitätskapazitäten verfügt und gleichzeitig ein kosteneffizienter Betrieb aufrechterhalten wird. Eskom Research Testing and Development (RT&D) hat ein Projekt ins Leben gerufen, um auf der Grundlage von Auslegungsgrenzen der Anlagen/Systeme und aktuellen Betriebsdaten der Kraftwerke potenzielle Verbesserungen der betrieblichen Flexibilität zu bewerten, zu evaluieren und zu identifizieren. Die Kontrolle der Zykluschemie und die Einhaltung der vorgeschriebenen Eskom-Zykluschemie-Standards waren einer der Schwerpunkte der Studie zur flexiblen Betriebsführung.
Unsicherheit bei den Werkstoffen P91/P92 in Kraftwerksanlagen – Wo stehen wir bei der Bewertung der Lebensdauer?
Ansgar Kranz, Albert Bagaviev und Alexander Kuhn
Betriebliche Flexibilität von Kohlekraftwerken und Kohlenstoffabscheidung
Qian Zhu
Die Halbierung unserer Energiekosten durch eine optimierte „Energiewende“ – Wie geht das?
José Gomes
Die Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie ist mittlerweile konkurrenzlos günstig, aber leider auch wetterabhängig. Damit lässt sich das „Leistungsgleichgewicht“ im Stromnetz nur durch eine „disponierbare“ Ausspeisung von Strom und durch eine zur Wind- und Solarenergie komplementäre Stromerzeugung aus Gaskraftwerken, die ausschließlich im Winterhalbjahr zur Ergänzung der Strom- und Wärmeversorgung benötigt werden, herstellen. Das Stromnetz der Zukunft benötigt ferner neben dem Ausbau der Transport- und Verteilnetze auch eine Flotte an „disponierbaren“ Verbrauchern und eine eher kleine Flotte an „disponierbaren“ Stromspeichern für den Regelenergiemarkt und zur Bereitstellung von Primärreserve.
IEA: Weltweite Energieinvestitionen 2025 – Zusammenfassung
Internationale Energieagentur (IEA)
Das Potenzial der Umstellung von Kohle auf Gas im Energiesektor erschließen
GEFC Gas Exporting Countries Forum
Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2024 – Elektrizitätswirtschaft
AG Energiebilanzen
Die deutsche Energieversorgung hat sich 2024 spürbar verbilligt. Im vergangenen Jahr betrug die um Ausfuhren saldierte Importrechnung für Kohle, Öl und Gas rund 69 Milliarden Euro, das waren rund 15 Prozent oder 12,4 Milliarden Euro (Mrd. Euro) weniger als 2023. Ein milder Witterungsverlauf, die weiterhin verhaltene konjunkturelle Entwicklung sowie statistische Effekte durch den Ausbau der erneuerbaren Energien haben 2024 zum einen für einen Rückgang des gesamten Energieverbrauchs um 1,2 Prozent geführt; die Veränderungen bei den Kosten für Energieimporte und der politische Ordnungsrahmen sorgten zum anderen für eine weitere Beschleunigung des strukturellen Wandels in der Energieversorgung. Im Gegensatz zum Primärenergieverbrauch nahm der Bruttostromverbrauch im Jahr 2024 in Deutschland zu. Zum Anstieg um 1,3 Prozent trugen das Produktionswachstum energieintensiver Branchen, die sich nach dem Einbruch im Vorjahr wieder etwas erholten, sowie Substitutionsprozesse zugunsten des Einsatzes elektrischer Energie in der Industrie bei.
Review: vgbe “Flue Gas Cleaning Workshop 2025”
vgbe energy
Fortschritte, Herausforderungen und neue Perspektiven
In elf Fachvorträgen wurde ein fundierter Überblick über den aktuellen Stand der Technik sowie zukünftige Herausforderungen in der Rauchgasreinigung vermittelt. Der Workshop fand vom 21. bis 22. Mai 2025 in der lettischen Hauptstadt Riga statt und wurde vom vgbe-Mitgliedsunternehmen AS Latvenergo unterstützt.
Editorial

Stefan Bogenberger
Head of Wind, PV & Battery Storage at Stadtwerke München (SWM)
Chairman of the TCC Wind Power at vgbe energy e.V.

Dr. Mario Bachhiesl
Head of Renewables at vgbe energy e.V.
Mehr als Aufwind – Windenergie im digitalen Wandel
Liebe Leserinnen und Leser,
die Windenergiebranche steht vor einem technologischen Umbruch. Bereits heute deckt Windstrom knapp ein Drittel des Stromverbrauchs in Deutschland und rund 19 % in der EU . Deutschland war 2024 führend beim Ausbau der Windkraft in Europa: Über 4 GW neue Leistung wurden installiert – davon entfielen rund 3,3 GW (82 %) auf Onshore-Anlagen1. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten Repowering-Projekte mit einer installierten Leistung von 1,1 GW. Gleichzeitig wurden 557 Windenergieanlagen an Land mit insgesamt 712 MW stillgelegt, was zu einem Netto-Zubau von rund 2,6 GW im Onshore-Segment führte2. Europaweit sind mittlerweile rund 285 GW Windleistung installiert – 248 GW Onshore und 37 GW Offshore.
Diese Dynamik erfordert neue Lösungen, um Betrieb und Netzintegration effizient zu gestalten. Trotz Herausforderungen etwa bei Genehmigungen und Netzausbau zeigen zahlreiche Entwicklungen, wie Digitalisierung, innovative Betriebsführung und verstärkte Systemdienlichkeit die Windenergie auf die nächste Stufe heben.
Digitalisierung im Windpark-Betrieb
Moderne Systeme zur Zustandsüberwachung erfassen kontinuierlich Betriebsdaten von Rotorblättern, Getrieben, Generatoren und Lagern. Diese Daten geben präzise Einblicke in den technischen Zustand der Anlagen und ermöglichen es, potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen – ein zentraler Schritt für mehr Effizienz, höhere Verfügbarkeit und bessere Planbarkeit.
Basierend auf diesen Daten kommen vermehrt Big-Data-Analysen und KI-basierte Auswertungen zum Einsatz. Sie reichen von der Ertragsoptimierung bis hin zur automatisierten Fehlerdiagnose – etwa bei der Analyse von Abweichungen der Leistungskennlinie oder ungewöhnlichen Schwingungsmustern.
Auch die zentrale Fernsteuerung ganzer Windpark-Portfolios wird zunehmend digitalisiert. Ein Beispiel: Die Stadtwerke München vermarkten den Windstrom ihrer Anlagen über die Softwarelösung PowerSystem von Enertrag. Rund 1.250 MW Windleistung – darunter 900 MW Offshore – lassen sich so standortübergreifend überwachen und steuern. Zugleich investieren IT-Konzerne verstärkt in Windsoftware, um integrierte Asset-Management-Lösungen für Betreiber und Betriebsführer bereitzustellen. Der Trend ist eindeutig: Vernetzung und datenbasierte Steuerung werden zum neuen Standard – von der Einzelanlage bis zur Flottenoptimierung.
Innovationen im Servicebetrieb
Auch der Servicebetrieb profitiert zunehmend von der Digitalisierung. Cloudbasierte Tools und mobile Anwendungen vereinfachen die Einsatzplanung, ermöglichen eine effizientere Organisation von Wartungsaufträgen und verbessern die Kommunikation zwischen Leitwarte und Serviceteam. Vor Ort arbeiten Techniker heute häufig mit robusten Tablets oder Smartphones, auf denen spezialisierte Service-Apps laufen. Diese bieten digitale Checklisten und Wartungsprotokolle, die automatisch auf den jeweiligen Anlagentyp zugeschnitten sind. Messwerte lassen sich direkt erfassen, Schadensbilder anhängen und bei Bedarf auch offline dokumentieren – die Synchronisation erfolgt später automatisch. Das Ergebnis: weniger Papierkram, höhere Datenqualität und beschleunigte Abläufe.
Ein weiterer Fortschritt ist der Einsatz von Drohnen zur Rotorblattinspektion. Sie ermöglichen eine schnelle und sichere Sichtprüfung auf Risse, Erosion oder mechanische Schäden, ohne den Einsatz aufwendiger Seilzugangstechnik. Innerhalb eines einzigen Flugs können alle drei Rotorblätter einer Anlage erfasst werden. Die gewonnenen Bilddaten, oft mehrere Hundert pro Turbine, werden anschließend vorselektiert, ausgewertet und dokumentiert.
So lassen sich Schäden exakt lokalisieren und im Zeitverlauf nachvollziehen – eine wertvolle Grundlage für Wartung, Reparatur und Qualitätsmanagement.
Die Richtung ist klar: Jede neue Technologie macht die Instandhaltung nicht nur effizienter und kostengünstiger, sondern erhöht auch die Verfügbarkeit der Windenergieanlagen nachhaltig.
Netzintegration und Systemdienlichkeit
Mit dem wachsenden Anteil an Windstrom gewinnt die Netzintegration an Bedeutung. Die gute Nachricht: Moderne Windparks entwickeln sich vom passiven Einspeiser zum aktiven Systemdienstleister. Sie stellen Blindleistung bereit und unterstützen so aktiv die Spannungsstabilität im Stromnetz.
Ein Beispiel: Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat als erster in Deutschland die marktbasierte Beschaffung von Blindleistung eingeführt. Betreiber können so zusätzliche Erlöse generieren und gleichzeitig zur Netzstabilität beitragen. Zwar bleiben Herausforderungen wie Engpässe und temporäre Abregelungen bestehen – doch auch hier bietet die Digitalisierung Lösungen: Mit verbesserten Einspeiseprognosen, intelligenter Laststeuerung und neuen Softwaretools lassen sich Eingriffe minimieren.
Die Windbranche zeigt eindrucksvoll, wie sich technische Hürden in Fortschritt umwandeln lassen. Digitale Betriebsführung, innovative Wartungskonzepte und netzdienliche Technologien treiben die Entwicklung kontinuierlich voran und stärken die Rolle der Windenergie als tragende Säule der Energiewende.
Bis 2030 erwartet WindEurope eine installierte Windleistung von rund 450 GW in Europa1. Dieses ambitionierte Ziel ist nur mit konsequenter technologischer Weiterentwicklung erreichbar. Doch die Richtung stimmt: Mit digitaler Unterstützung und einem klaren Innovationskurs wird die Windindustrie nicht nur ihre Position festigen, sondern weiter ausbauen. Jede neue Anwendung, jede Optimierung und jede netztechnische Lösung bringen uns diesem Ziel näher.
Wissen gemeinsam nutzen – vgbe energy
Die vgbe energy begleitet diese Entwicklungen aktiv. In technischen Gremien, praxisnahen Expert-Workshops und gemeinsamen Forschungsprojekten tauschen sich Mitglieder über Themen wie Betriebsführung, Digitalisierung und Instandhaltung aus. Dabei entstehen nicht nur konkrete Lösungen für den Alltag, sondern auch wertvolle Impulse für Innovationen und Standards.
Durch das gezielte Teilen von Erfahrungen, Daten und Best Practices wächst das kollektive Know-how der Branche. Synergien werden genutzt, Fortschritte gemeinsam erzielt – ganz im Sinne unseres Mottos:
Wissen gemeinsam nutzen – Windenergie gemeinsam voranbringen.