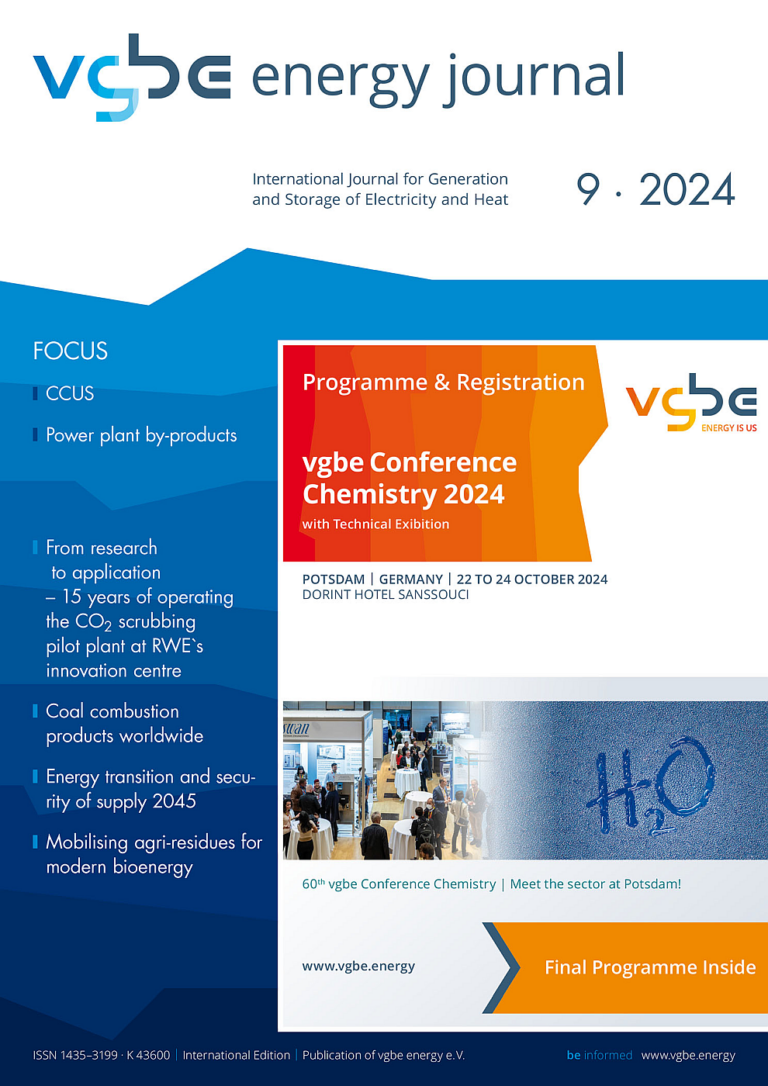Die Renaissance von CCS und CCU: Chancen und Herausforderungen im globalen Kontext
Christopher Weßelmann
Im Zuge der Diskussion um den Klimawandel werden die Optionen der Kohlenstoffabscheidung und -nutzung (Carbon Capture and Storage, CCS, und Carbon Capture and Utilization, CCU) wieder intensiver betrachtet. Diese Technologien, die jahrzehntelang im Hintergrund standen, erleben nun weltweit eine Renaissance. Ihr Einsatz ist jedoch nicht frei von Herausforderungen noch von gesellschaftlich, politischen Widerständen. Um das Potenzial von CCS und CCU zu verstehen, müssen die Entwicklungen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene betrachtet werden. Zudem ist einzuordnen, inwieweit sie zur Erreichung der Klimaziele beitragen können.
Auf globaler Ebene ist ein wachsendes Interesse an CCS und CCU zu beobachten, das durch die verschärften internationalen Klimaziele und die Notwendigkeit, Emissionen in Sektoren mit geringen Möglichkeiten einer direkter Emissionsminderung getrieben wird. Vor allem Länder wie die USA und China, aber auch Australien und Kanada, investieren massiv in die Entwicklung und den Ausbau von CCS-Anlagen. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act (IRA) 2022 einen finanziellen Anreiz für CCS-Projekte geschaffen. Die Entwicklung dieser Technologien wird dort nicht nur als Möglichkeit gesehen, die CO2-Emissionen zu senken, sondern auch als Chance, die heimische Industrie zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen.
Von der Forschung in die Anwendung – 15 Jahre Betrieb der CO2-Wäsche-Pilotanlage im Innovationszentrum von RWE in Niederaußem und Nutzung der Ergebnisse
Peter Moser, Georg Wiechers, Sandra Schmidt, Ferdinand Steffen und Peter Lindemann
Die Szenarien des Weltklimarates und der internationalen Energieagentur sehen zur Erreichung der Klimaschutzziele die Notwendigkeit, CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCUS) weltweit umzusetzen. Negative Emissionen – also die permanente Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre – können z.B. durch die geologische Speicherung von biogenem CO2 (BECCS) realisiert werden. Zudem kann der CO2-Gehalt in der Atmosphäre durch Substitution von fossilen Roh- und Treibstoffen durch e-Chemicals und e-Fuels gesenkt werden, wenn diese aus biogenem CO2 und mittels erneuerbaren Stromes erzeugtem H2 produziert werden (BECCU). RWE Power ist seit mehr als 20 Jahren aktiv in der Entwicklung und Erprobung von CO2-Abtrennungtechniken in Anlagentests unter realen Einsatzbedingungen. Das Herzstück ist hierbei die seit 15 Jahren in Betrieb befindliche CO2-Wäsche-Pilotanlage in Niederaußem, an der in 115.000 Stunden 24/7-Betrieb seit der Inbetriebnahme 2009 alle relevanten technischen, wirtschaftlichen und Umweltaspekte der Aminwäschetechnik untersucht werden. Die Erfahrungen aus dem Langzeitbetrieb und im Rahmen laufender internationaler Forschungsprojekte in Niederaußem gewonnene Ergebnisse zum Waschmittelmanagement, zur Emissionsminderung und zu höchsten CO2-Abtrenngraden fließen direkt in das derzeit von RWE geplante BECCUS-Projekt am Knapsacker Hügel ein, in dem biogenes CO2 aus dem Rauchgas von Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen abgetrennt und wahlweise gespeichert oder genutzt werden soll.
Kraftwerksnebenprodukte weltweit: Auf dem Weg von der Eignung zur Nachhaltigkeit
Thomas Adams, Craig Heidrich, Jinder Jow und Joachim Feuerborn
Kohle wird weltweit zur Energie- und Wärmeerzeugung genutzt, mit Vor- und Nachteilen sowie Einschränkungen oder Ausstiegsbeschlüssen in Teilen der Welt aus Umweltgründen. Basierend auf veröffentlichten Verpflichtungen zum Kyoto-/Paris-Protokoll wird die Kohlenutzung in mehr als 90 % der Länder des Anhangs I bis 2050 auslaufen. In allen Regionen der Welt haben die Nutzer von Kraftwerksnebenprodukten der Kohle (CCPs) zunehmend Folgen zu bewältigen, d.h. mit Qualitätsproblemen bei CCPs, die durch den diskontinuierlichen Betrieb entstehen, und mit weniger verfügbaren CCPs für den Bausektor. Um den Bedarf des Bausektors zu decken, nimmt der Rückgriff von CCPs aus Langzeitlagern zu, da der Ausstieg aus der Kohleenergie weltweit voranschreitet. Die Forschung zu diesen CCPs, zur Verwendung anderer Arten von Kohleasche mit und ohne Verarbeitungsbedarf und zu Mischungen mit anderen Materialien entwickelt sich weiter. Die Entwicklungen sind teilweise bereits in Normen und Richtlinien enthalten. Der Bericht gibt einen aktuellen Überblick über die Situation mit CCPs weltweit, über teilweise notwendige Nachhaltigkeitsaspekte und Entwicklungen bei Normen.
Nachhaltiges Bauen mit Kraftwerksnebenprodukten – ein Update für Europa
Fabrice Fayola und Joachim Feuerborn
In Europa schreitet die Entwicklung in Richtung CO2-Neutralität bis 2050 voran, was sich auf die Produktion mit fossilen Brennstoffen, aber auch auf Baumaterialien und das Bauwesen auswirkt. Für die Energie- und Wärmeerzeugung aus fossilen Brennstoffen führt dies zu einer verstärkten Erzeugung durch erneuerbare Energien bzw. zu einer diskontinuierlichen Erzeugung durch Kohlekraftwerke und damit zu Verfügbarkeitsproblemen bei Kraftwerksnebenprodukte (Coal Combustion Products CCPs). Obwohl sie seit Jahrzehnten bekannt ist und verwendet wird, ist insbesondere Flugasche Gegenstand eines zunehmenden Interesses für die Herstellung von kohlenstoffreduziertem Zement und Beton. Die Produktion von Kraftwerksnebenprodukten in Kohlekraftwerken in Europa beläuft sich immer noch auf etwa 75 Millionen Tonnen mit abnehmender Tendenz. Neben direkte Herstellung in Kraftwerken wird insbesondere Flugasche aus Deponien mit gemeinsamer Ablagerung von Flugasche und Kesselasche untersucht. Zur Deckung des Bedarfs wird Flugasche auch aus anderen Ländern importiert. Neben Kraftwerksnebenprodukten dienen auch andere Alternativen als Roh- oder Baustoff, die teilweise nur regionale Bedeutung haben. Der Bericht gibt einen aktuellen Überblick über die unterschiedlichen Entwicklungen der Marktbedürfnisse und -optionen durch kohlenstoffarme Produkte.
Energiewende und Versorgungssicherheit 2045
Dunkelflauten erfordern Handeln!
Markus J. Löffler
Deutschlands Stromversorgung soll im Jahr 2045 gemäß aktueller Planung (z.B. EEG 2023) ausschließlich mit Hilfe erneuerbarer Energien geschehen. Hierzu gehören Wind- und Solarkraft und in erheblichst geringerem Maße Biomasse- und Laufwasserkraft. Bekannt ist, dass die Energiezufuhr aus diesen Energiequellen überwiegend volatil und daher inkompatibel mit dem Strombedarf der Verbraucher ist. Ohne weitere Maßnahmen käme es ständig zu Über- oder Unterversorgungssituationen mit der Folge dauerhafter Blackouts. Während eine Überversorgung im einfachsten Fall mit dem rechtzeitigen, wenn auch unwirtschaftlichen Abschalten der entsprechenden Energieversorger sehr gut beherrschbar ist – andere Maßnahmen sind die Speicherung der überschüssigen Energie oder deren Export, sofern es das Ausland zulässt –, ist die Darstellung der Versorgungssicherheit im Falle einer Unterversorgung, also die Vermeidung ewiger Blackouts, nur mit Hilfe zusätzlicher aktiv steuerbarer Energiequellen darstellbar.
Was wäre, wenn Deutschland in Kernenergie investiert hätte?
Ein Vergleich zwischen der deutschen Energiepolitik der letzten zwanzig Jahre und einer alternativen Politik der Investitionen in Kernenergie
Jan Emblemsvåg
Mobilisierung von Agrarrückständen für moderne Bioenergie
Jenny Jones, Leilani Darvell und Bijal Gudka
Ein Leitfaden zur Integration von Biodiversität in erneuerbare Energien und Netzprojekte
Eurelectric
vgbe Summer School 2024 – Bericht
vgbe energy
Vom 26. bis 30. August 2024 hat die 51. vgbe Summer School stattgefunden. Die vgbe FORSCHUNGSSTIFTUNG hat erneut die Finanzierung der Summer School übernommen, um dem akademischen Nachwuchs einen intensiven Einblick in die Energiebranche zu vermitteln. vgbe hat 18 Studierende aus dem In- und Ausland begrüßt und wie in den vergangen 50 Jahren ein spannendes und eindrucksvolles Programm durchgeführt.
Editorial
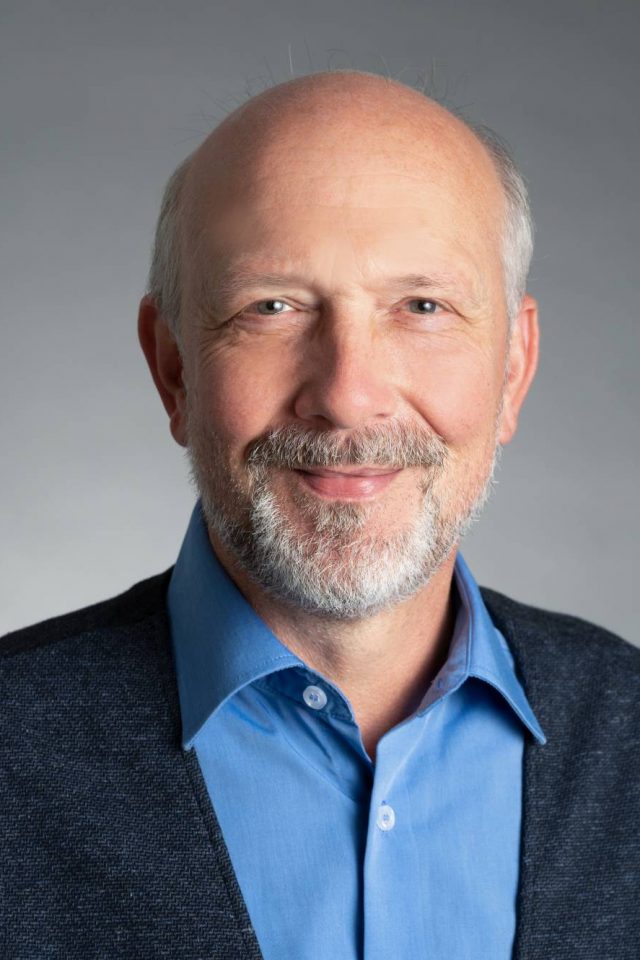
Christopher Weßelmann
Chefredakteur vgbe energy
Die Renaissance von CCS und CCU: Chancen und Herausforderungen im globalen Kontext
Liebe Leserinnen und Leser,
Im Zuge der Diskussion um den Klimawandel werden die Optionen der Kohlenstoffabscheidung und -nutzung (Carbon Capture and Storage, CCS, und Carbon Capture and Utilization, CCU) wieder intensiver betrachtet. Diese Technologien, die jahrzehntelang im Hintergrund standen, erleben nun weltweit eine Renaissance. Ihr Einsatz ist jedoch nicht frei von Herausforderungen noch von gesellschaftlich, politischen Widerständen. Um das Potenzial von CCS und CCU zu verstehen, müssen die Entwicklungen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene betrachtet werden. Zudem ist einzuordnen, inwieweit sie zur Erreichung der Klimaziele beitragen können.
Auf globaler Ebene ist ein wachsendes Interesse an CCS und CCU zu beobachten, das durch die verschärften internationalen Klimaziele und die Notwendigkeit, Emissionen in Sektoren mit geringen Möglichkeiten einer direkter Emissionsminderung getrieben wird. Vor allem Länder wie die USA und China, aber auch Australien und Kanada, investieren massiv in die Entwicklung und den Ausbau von CCS-Anlagen. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act (IRA) 2022 einen finanziellen Anreiz für CCS-Projekte geschaffen. Die Entwicklung dieser Technologien wird dort nicht nur als Möglichkeit gesehen, die CO2-Emissionen zu senken, sondern auch als Chance, die heimische Industrie zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen.
China wiederum hat CCS als Schlüsselelement in seiner Strategie zur CO2-Neutralität bis 2060 verankert. Es überrascht nicht, dass das Land, das größter Emittent von Treibhausgasen ist, versucht, seine Schwerindustrie mit Hilfe von CCS-Technologien zu dekarbonisieren. Gleichzeitig sieht sich China mit Herausforderungen konfrontiert, die über die reine technologische Entwicklung hinausgehen: Die gesellschaftliche Akzeptanz und die damit verbundenen Kosten machen den flächendeckenden Einsatz von CCS schwierig.
In Australien spielt CCS eine wichtige Rolle, da das Land eine lange Tradition im Export von fossilen Brennstoffen hat und seine Energieversorgung stark auf Kohle und Gas basiert. Die Möglichkeit, CO2-Emissionen direkt an der Quelle abzutrennen und zu speichern, bietet Australien eine Alternative, seine Industrie zu modernisieren und gleichzeitig seine Exportmärkte abzusichern. Ähnlich verhält es sich in Kanada, das als eines der ersten Länder ein umfassendes CCS-Programm implementiert hat und heute als einer der globalen Vorreiter in der Forschung und Entwicklung dieser Technologien gilt.
Auch Europa erkennt zunehmend die strategische Bedeutung von CCS und CCU, um die Netto-Null-Emissionsziele bis 2050 zu erreichen. Die Europäische Union fördert den Einsatz dieser Technologien im Rahmen des „Green Deal“ und sieht in CCS und CCU eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wie für Baustoffe, Chemie und Stahl. Der Fokus liegt hierbei auf grenzüberschreitenden Projekten, um die Synergien zwischen den Mitgliedsstaaten zu nutzen. Dies zeigt sich insbesondere bei Großprojekten wie dem „Northern Lights“-Projekt in Norwegen, das in Zusammenarbeit mit den Niederlanden und weiteren europäischen Partnern eine grenzüberschreitende CO2-Transport- und Speicherinfrastruktur aufbaut.
Trotz der Fortschritte gibt es in Europa erhebliche Hürden für die Umsetzung. Ein zentrales Problem ist nach wie vor das Fehlen an Speicherkapazitäten. Während Norwegen über umfangreiche geologische Formationen verfügt, die für die CO2-Speicherung genutzt werden können, fehlen anderen Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden aktuell entsprechende Optionen.
Zudem stößt CCS in vielen Ländern auf gesellschaftliche Widerstände, da die Speicherung von CO2 in unterirdischen Formationen mit Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Umweltauswirkungen verbunden ist.
Die Debatte über CCS und CCU zeigt deutlich, dass es sich hierbei um mehr als nur technologische Herausforderungen handelt. Es geht um eine strategische Entscheidung darüber, wie wir künftig mit unvermeidbarem CO2 umgehen wollen. Während CCS darauf abzielt, das CO2 dauerhaft zu speichern, setzt CCU auf die Umwandlung des Kohlenstoffs in nutzbare Produkte.
Ein Vorteil von CCU ist, dass es eine unmittelbare wirtschaftliche Nutzung von CO2 bietet und somit ein Geschäftsmodell schaffen kann, das die Akzeptanz dieser Technologien erhöht. Gleichzeitig ist die Umwandlung von CO2 oft energieintensiv und teuer, was dazu führt, dass viele Projekte derzeit noch auf umfangreiche Subventionen angewiesen sind. CCS hingegen könnte theoretisch eine effektive Methode sein, um große Mengen an CO2 zu binden – vorausgesetzt, geeignete Speicherorte sind vorhanden. Das führt wiederum zu der Frage, wie viel Vertrauen die Gesellschaft in diese Speichertechnologie hat und ob mögliche Leckagen langfristig ausgeschlossen werden können.
CCS und CCU stehen an einem Scheideweg. Während die Technologien auf globaler Ebene als notwendige Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele anerkannt werden, bleibt ihre gesellschaftliche und politische Akzeptanz vor allem in Europa ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg. Es zeigt sich, dass der Weg zur klimaneutralen Zukunft keine einfachen Lösungen bietet. CCS und CCU könnten – richtig eingesetzt – einen wichtigen Beitrag leisten, aber sie müssen in ein umfassendes Konzept integriert werden, das sowohl technologische als auch soziale und politische Aspekte berücksichtigt.
Die Zukunft von CCS und CCU wird davon abhängen, ob es gelingt, die Balance zwischen technischen Möglichkeiten, wirtschaftlicher Machbarkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz zu finden. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass dieser Prozess bereits in vollem Gange ist – und dass die nächsten Jahre entscheidend sein werden, um zu bestimmen, ob diese Technologien Teil der Lösung sein werden.