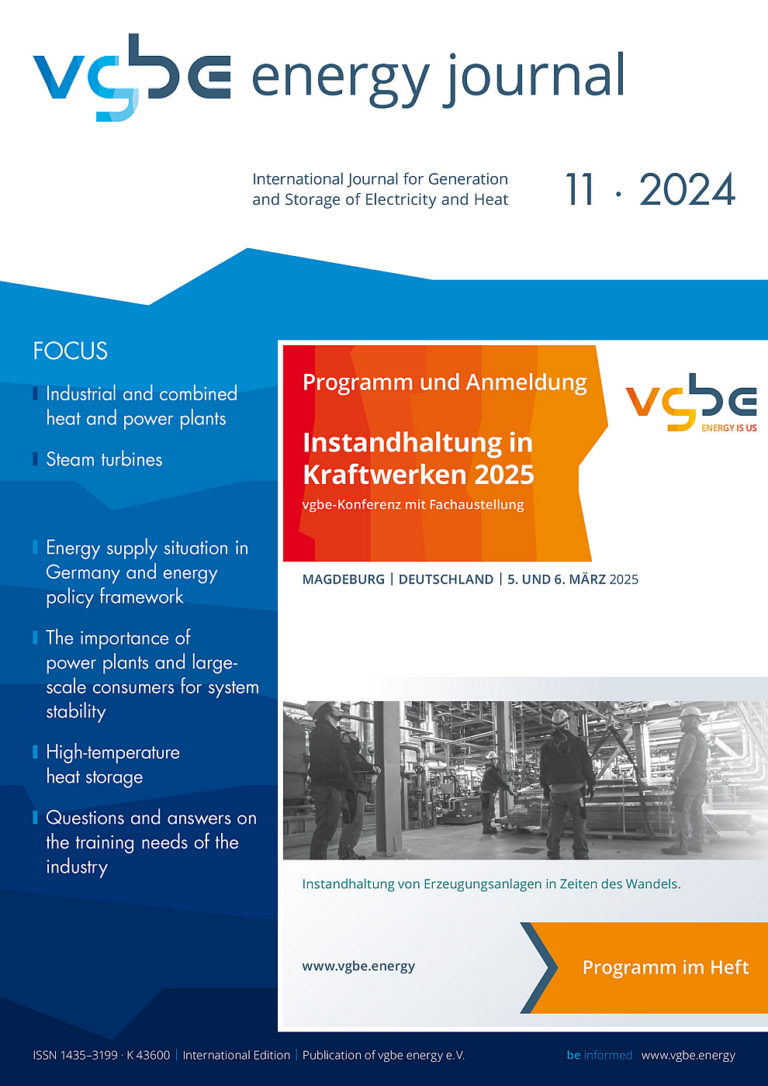Tiefgreifende Veränderungen in der Energiewirtschaft
Thomas Bahde
die Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Im Zuge der Energiewende soll die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas gelingen, um den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Energie durch Digitalisierung und den Ausbau der Elektromobilität. Zu den größten Herausforderungen zählen der Ausbau erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarenergie, die Modernisierung der Netzinfrastruktur und die Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung. Neue Technologien wie Wasserstoff, Energiespeicherlösungen und intelligente Netze (Smart Grids) spielen dabei eine Schlüsselrolle, um die Energieversorgung der Zukunft klimaneutral und effizient zu gestalten.
Situation der Energieversorgung in Deutschland und energiepolitische Rahmensetzung
Hans-Wilhelm Schiffer
Die akute Versorgungskrise, ausgelöst durch Russland, ist überwunden. Der Verbrauch an Energie in Deutschland ist deutlich zurückgegangen. Russland spielt als Energie-Rohstofflieferant für Deutschland keine maßgebliche Rolle mehr. Die Importpreise für Erdgas sowie für Rohöl und Steinkohle haben gegenüber den Ende August 2022 erreichten Höchstständen wieder nachgegeben. Auch die Rohölpreise sind gesunken. Allerdings sind die Importpreise für Erdgas und für Steinkohle immer noch doppelt so hoch wie im vergangenen Jahrzehnt. Dies spürt der Verbraucher bei seiner Heiz- und Stromrechnung. Mittelständische Unternehmen und Industrie sind ebenfalls weiterhin stark belastet. Hinzu kommt, dass die Sicherheit und Preiswürdigkeit der Stromversorgung in Frage steht. Die Energiepolitik hat in den vergangenen Jahren, und nicht erst seit 2021, widersprüchlich auf die bestehenden Herausforderungen reagiert. Eine Anpassung des Kurses ist geboten, damit die Energieversorgung ihrer Rolle als einer der zentralen Antriebsmittel für die wirtschaftliche Entwicklung gerecht werden kann.
Fragen und Antworten zu Fortbildungsbedarfen der Branche
Jens Hackforth
Im Zuge der Energiewende hat die Energiebranche in Deutschland in den vergangenen Jahren größte Anstrengungen unternommen, um neue Wege bei der Wärme- und Stromerzeugung zu gehen. Neben politischen, strategischen und finanziellen Aspekten stehen vor allem die Menschen im Mittelpunkt dieser Kraftanstrengungen. Denn trotz Computerunterstützung, IT, OT oder KI sind für viele Unternehmen gut ausgebildete Menschen die Basis des Erfolges. Grund genug sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Aus- und Fortbildungen für die Energiebranche zeitgemäß sind und die Menschen gut genug qualifizieren, um den neuen Anforderungen der Branche gerecht zu werden. In diesem Kontext erwähnenswert ist auch der Mangel an Fachkräften.
Bedeutung von Erzeugungsanlagen und Großverbrauchern für die Systemstabilität
Moritz Mittelstaedt, Janek Massmann und Tobias Hennig
Die Integration der geplanten Offshore-Windenergieanlagen und der insgesamt von der Bundesregierung angestrebte beschleunigte Zubau von EE-Erzeugungsanlagen bei gleichzeitigem starkem Anstieg des Verbrauchs sorgt absehbar für sehr hohe Leistungstransite in deutschen Übertragungsnetz. Gleichzeitig werden mit dem Abschalten der letzten Kohlekraftwerke bis 2030 nur noch wenige großen Synchronmaschinen das System stützen können. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) stärken das Netz mit eigenen Anlagen, wie beispielsweise STATCOM-Anlagen mit Kurzzeitspeicher oder rotierende Phasenschieberanlagen mit zusätzlicher Schwungmasse. Diese Maßnahmen werden allerdings allein nicht ausreichen, um die Stabilität auf dem heutigen Niveau aufrechtzuerhalten. Der Artikel gibt einen Überblick über die Situation der Systemstabilität in Bezug auf die Frequenzstabilität, die notwendigen Maßnahmen und deren Folgen und Chancen für Erzeugungsanlagen und Großverbraucher geben.
Konzeptionierung einer Industrie-Dampfturbine vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Energiemarktes
Stephan Schwab und Mario Küppers
Elektrolyse in der Praxis – Chancen und Risiken
Alexander Detke
Im Rahmen der Energiewende nimmt die Nachfrage nach grünem Wasserstoff rapide zu. Laut IEA wird sich der jährliche Bedarf an Wasserstoff weltweit bis zum Jahr 2030 auf circa 210 Millionen Tonnen verdoppeln und bis 2050 auf 300 bis 600 Millionen Tonnen steigen. Die günstigste Methode, diesen Bedarf zu decken, wäre laut Berechnungen des Wuppertal Institut die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff vor Ort mittels Elektrolyse. Erläutert wird, welche Faktoren Betreiber von Wasserstoffanlagen und Projektierer für die Berechnung der Wasserstoffgestehungskosten, der sogenannten LCOH (Levelized Cost of Hydrogen), herangezogen werden können. Chancen und Erfolgsfaktoren für den Einstieg in Elektrolyseprojekte werden vorgestellt.
Reduzierung der CO2-Emissionen in die Umwelt durch den effektiven Einsatz von Hochtemperaturwärmespeichern
Nico Bronsert
Das Konzept CO2-freier Prozesswärme passt optimal zu dem auf Nachhaltigkeit und ökologischem Bewusstsein ausgelegten Geschäftsmodell der Biosparte der Lebensmittelindustrie. Auch für Unternehmen anderer Branchen wird der auf dem Speichermedium Stahl basierende Hochtemperaturwärmespeicher (TES) immer attraktiver. Hohe und volatile Energiekosten sowie der steigende CO2-Preis sind dafür die entscheidenden Treiber. Mit seinem TES aus Stahl hat LUMENION den Beweis angetreten, dass die Spitzen aus Wind- und Sonnenenergie kostengünstig zwischengespeichert und später bedarfsgerecht im industriellen Maßstab genutzt werden können. Mit diesen CO2-freien Speichersystemen wird der Industrie der Einstieg in die Dekarbonisierung und in eine kostengünstige Nutzung von Erneuerbaren Energien für die Prozesswärme ermöglicht.
Erneuerung der Inneneinbauten im Naturzugkühlturm des Kraftwerkes Rostocks
Torsten Mager und Helena Eisenkrein
Aufgrund der umfangreichen Schädigung der Inneneinbauten des Naturzugkühlturmes des Kraftwerkes Rostock war eine schrittweise Sanierung der Betonfertigteile nicht mehr möglich. Nach einem Schadensereignis begannen die Planung und Vorbereitung des Ersatzneubaus sämtlicher Bauteile mit Ausnahme des zuführenden Wasserkanals sowie der Steigeschächte. Durch einen straffen Zeitplan und mit räumlich versetzten gleichzeitigen Arbeiten der Partnerfirmen konnte die Bauzeit von annähernd sechs Monaten eingehalten werden. Der Kühlturm steht dem Kraftwerk wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung, das Kraftwerk unterliegt wieder den Lastanforderungen des Netzbetreibers.
Multifuel-Anwendung für bestehende Kraftwerke zur Deckung der Energieversorgungslücke
Lutz Brandau, Anojan Santhirasegaran und Benedikt Tressner
Der Begriff Fuel Switch bezeichnet den Wechsel von klimaschädlicher Kohle auf grüne Energie bzw. Brennstoffe. Die technische Umsetzbarkeit mit hoher Flexibilität in der tatsächlich verfügbaren Brennstoffart ist oft eine Herausforderung. Grundsätzlich ist es fast immer möglich, eine Altanlage umzurüsten. Ausgehend von einem modernen Steinkohlekessel werden Maßnahmen zur Einhaltung der Dampfparameter und des nahezu ursprünglichen Kesselverhaltens aufgezeigt. Ebenso werden die notwendigen Umbaumaßnahmen für eine brennstoffoffene Umrüstung dargestellt. Der Beitrag gibt einen Einblick in die aktuellen Fragestellungen der Betreiber zur Umrüstung bestehender Anlagen auf alternative Brennstoffe mit unterschiedlichem Potenzial zur Defossilisierung sowie Lösungsmöglichkeiten zur Umsetzung.
Minderung der Staub- und Kohlenstoffmonoxidemissionen in einem Biomasseheizkraftwerk
Christian Gollmer, Theresa Siegmund and Martin Kaltschmitt
Neues Universal-Tool zur Produkt- und Prozessoptimierung
Udo Hellwig
Editorial

Thomas Bahde
Vorsitzender vgbe TC Industrie und Heizkraftwerke
BEW Berliner Energie und Wärme AG
Leiter technische Beschaffung
Tiefgreifende Veränderungen in der Energiewirtschaft
Liebe Leserinnen und Leser,
die Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Im Zuge der Energiewende soll die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas gelingen, um den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Energie durch Digitalisierung und den Ausbau der Elektromobilität. Zu den größten Herausforderungen zählen der Ausbau erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarenergie, die Modernisierung der Netzinfrastruktur und die Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung. Neue Technologien wie Wasserstoff, Energiespeicherlösungen und intelligente Netze (Smart Grids) spielen dabei eine Schlüsselrolle, um die Energieversorgung der Zukunft klimaneutral und effizient zu gestalten.
Doch nicht nur im Bereich der Technologie müssen wir uns an neue Bedingungen anpassen, sondern vor allem auch im Bereich der Fortbildung. Angesichts des Umstiegs von fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas auf erneuerbare Energien wie Wind, Geothermie, Solar und Biomasse, verändern sich die Anforderungen an Fachkräfte in der Branche grundlegend. Es reicht nicht mehr aus, traditionelles technisches Know-how zu beherrschen; neue Kompetenzen in Bereichen wie Digitalisierung, Automatisierung, und vor allem der Handhabung und Integration erneuerbarer Technologien sind gefragt.
Um im Rahmen der Energiewende auch die Wärmewende zu vollziehen kommen auf alle Wärmelieferanten neue Herausforderungen zu. Die Abkehr von fossilen Primärenergieträgern wie Gas, Erdöl(Heizöl) und Kohle zu Wärmeversorung von Haushalten und Kommunen wirft die Frage auf WIE?
Eine Möglichkeit bestehende Fernwärmenetze weiterhin mit Wärme zu versorgen sind Wärmepumpen. Derzeit werden etliche Großaggregate ( >20 MWth ) geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Als Wärmequellen werden hierbei Flüsse und Umgebungsluft genutzt. Zu beachten sei hierbei, dass für den Betrieb dieser Pumpen elektrische Energie benötigt wird. Der derzeitige COP dieser Pumpen liegt um 2 bestenfalls auch 3. Was bedeutet das? Um z.B. 20 MWth zu generieren werden zwischen 7 und 10 MWel benötigt.
Klassische Stadtwerke die ihren Wärmebedarf durch KWK Anlagen gedeckt haben, werden nun von elektrischen Produzenten zu elektrischen Verbrauchern. Mit anderen Worten unser heutiger elektrischen Bedarf von 517 TWh pro Jahr [2023, statista2024] wird sich durch den Einsatz von Wärmepumpen weiter erhöhen.
Auch sei an dieser Stelle die Frage erlaubt wie der Spitzen Wärmebedarf einer Großstadt wie Berlin (ca. 3000 MWth) einzig durch den Zubau von Wärmepumpen gedeckt werden kann. Und diese Leistung ist nur die, die der örtliche Energieversorger derzeit bereitstellt. Dazu kommen noch die privaten und industriellen Feuerstätten.
Eine weitere Möglichkeit bietet die Tiefengeothermie. Das Besondere ist hier, nicht jeder kommunale Wärmeversorger sitzt auf geologisch geeigneten Untergrund. Die Thermalwassernutzung in einem geschlossenen Kreislauf scheint zunächst unbedenklich zu sein. Da aber nach geltenden physikalischen Regeln jede actio auch eine reactio hervorruft, sollte sehr genau geprüft sein, wie sich der Wärmeentzug in tiefen Erdschichten auswirkt.
Ebenfalls werden das Themenfeld Wasserstoff und deren Herstellung sowie der Verteilung im gesamten Bundesgebiet noch viele ingenieurstechnische Fragestellung begleiten.
Es ist wohl noch viel zu tun und zu bedenken, bis wir CO2 neutral sind. Packen wir es gemeinsam an.