KI und Stromerzeugung – Herausforderung für die Energiesysteme?
Christopher Weßelmann
Die Dynamik, mit der Künstliche Intelligenz – KI – in nahezu allen gesellschaftlichen und ökonomischen Bereichen Einzug hält, übertrifft derzeit die Geschwindigkeit vieler früherer technologischer Umwälzungen. Anwendungen reichen von der medizinischen Diagnostik über automatisierte Produktionsprozesse bis hin zu selbstlernenden Finanzsystemen oder der Steuerung hochkomplexer Lieferketten. Mit der rasanten Verbreitung von KI wächst jedoch auch eine neue Dimension des Energiebedarfs, die vor allem die Stromerzeugung unter erheblichen Druck setzt. Was bislang als schleichender Zuwachs erschien, nimmt durch die rapide Zunahme an Rechenzentren und die Entwicklung energieintensiver KI-Modelle eine Form an, die die Energiebranche nicht ignoriert.
Rechenzentren, die das Rückgrat der KI-Infrastruktur bilden, haben sich von klassischen Datenspeichern hin zu Hochleistungsclustern entwickelt, deren Stromverbrauch exponentiell steigt. Das Training und der Betrieb großskaliger neuronaler Netze benötigen mittlerweile elektrische Leistungen im dreistelligen Megawattbereich pro Standort. Parallel zur Leistungsaufnahme wächst auch die Anforderung an eine sichere, ausfallfreie und hochflexible Stromversorgung. Strombedarfe dieser Größenordnung entstehen nicht nur punktuell, sondern in Ballungsräumen, in denen der Wettbewerb um Netzkapazitäten ohnehin hoch ist. Damit verschärft sich ein Zielkonflikt zwischen traditioneller Versorgungssicherheit, dem notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien und dem steigenden Anspruch neuer, digital getriebener Industrien.
Russisches Gas als Motor für das Wirtschaftswachstum in Deutschland – Realität oder Mythos?
Hans-Wilhelm Schiffer und Andreas Seeliger
In der öffentlichen Debatte werden russische Erdgaslieferungen oft als besonders günstig und als wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand in Deutschland beschrieben. In diesem Artikel zeigen wir, dass russische Lieferungen aufgrund der Marktbedingungen und der Preisbildungsmechanismen in der Energiebranche nicht wesentlich günstiger waren als Erdgas aus anderen Exportländern. Darüber hinaus scheint die Bedeutung des Erdgaspreises für die deutsche Wirtschaft in der Debatte überbewertet zu werden.
Effiziente Lecksuche an Kraftwerken und Industrieanlagen
Steffen Griebe, Markus Laps, Victoria und Emma Lambert
Betriebsleistung, Sicherheit und Konformität mit Umweltvorschriften sind in modernen Kraftwerken und Industrieanlagen von größter Bedeutung. Unentdeckte Lecks, definiert als unbeabsichtigte Flüssigkeits- oder Gasdurchgänge durch Gehäusewände, stellen eine erhebliche Bedrohung dar und führen zu wirtschaftlichen Verlusten und Sicherheitsrisiken. In diesem Beitrag wird ein systematischer, methodenübergreifender Ansatz zur Lecksuche vorgestellt, der darauf abzielt, Materialverluste zu minimieren, Verunreinigungen zu vermeiden und die Zuverlässigkeit der Anlagen zu gewährleisten. Zu den diskutierten Schlüsseltechnologien gehören akustische Leckbildgebung, Helium-/Wasserstoff-Tracergasdetektion, Nebelvisualisierung und Strömungsgeschwindigkeitsmessungen.
Steigerung der Sicherheit durch Freischaltungsplanung im Digitalen Informationszwilling
Hans Karl Preuß und Jessica Nentwich
Das „Wissen“ des Digitalen Informationszwillings und insbesondere das R&I kann genutzt werden, Freischaltpläne auf visueller Basis zu erstellen: Direkt im R&I wird definiert, welche Maßnahmen für welches Aggregat erforderlich sind. Farbliche Markierungen im R&I verdeutlichen die geplante Maßnahme und ermöglichen so auch, eventuelle Fehler schon in der Planung zu korrigieren – um sie in der Realität zu vermeiden. Die Planung kann gespeichert und z.B. für die nächste Freischaltung wiederverwendet werden.
Wie Drohnentechnologie die Instandhaltung von Kraftwerken revolutioniert
Susanne Kumm, Simon Kumm und Waltraud Engel
Um die Wartung langfristig zu optimieren, sollten Betreiber von Energieanlagen auf neue Lösungen setzen: Moderne Technologie mit und auf Drohnen basierend schont Ressourcen in Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen. In Zeiten, in denen aufgrund des demografischen Wandels immer weniger Fachkräfte für Inspektionen zur Verfügung stehen, sind solche technologische Fortschritte unerlässlich. Die Wanddickenmessung, die seit Jahrzehnten erfolgreich die Wartung durch manuelle Messungen unterstützt, kann nun nahezu uneingeschränkt vom Anlagenstandort eingesetzt werden. Die Wanddickenmessung mit Drohnen kann proaktiv eingesetzt werden, was den Prozess erheblich vereinfacht. Dadurch können Ausfallzeiten verkürzt und die Lebensdauer von Anlagen deutlich verlängert werden.
Die Rolle von Lebenszyklusanalysen in der Energiewende: Verlängern statt ersetzen
Wim Schepers, Meüs van der Poel, Frits Engelage, Jan van den Bos und Lisa Lubbers
Ist eine Nachnutzung gebrauchter Kraftwerkstechnik sinnvoll?
Andreas Stephan und P. Joel Stephan
Die Energiewirtschaft befindet sich in stetigem Umbau, was laufend Erneuerungen der weiterhin benötigten Kraftwerkstechnik erforderlich macht. Was passiert also mit den bestehenden, noch betriebsbereiten Anlagen und Komponenten? Lohnt es sich noch, Geld und Mühe in einen Verkauf zu stecken? In diesem Artikel, der auf realen Marktdaten und Erfolgsgeschichten basiert, geben wir einem Überblick über die Situation im Gebrauchtmarkt für thermische Kraftwerke und zeigen Optionen für Betreiber und Investoren gleichfalls.
Ölverunreinigung von Maschinenkondensat in einem Kraftwerk – Ursache, Reinigungskonzept und Langzeiterfahrungen
Anna Krein, Stefan Wenke und Sven Scholtka
Ein Kraftwerksblock der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) in Boxberg wurde zur disponiblen Reparatur einer Einspritzung am Dampferzeuger außer Betrieb genommen. Während der Außerbetriebnahme des Blockes wurde ein sinkender Füllstand im Lagerölbehälter der Turbo-Kesselspeisepumpe festgestellt. Nach intensiver Suche konnte der Verlauf der Ölleckage detektiert werden. Aus bis dahin nicht erkennbaren Gründen gelangte das Öl der Kesselspeisepumpe in das Hauptkondensatsystem, wobei zwischen beiden Systemen keine direkte Verbindung besteht. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass durch ungünstige Konstellationen im Abfahrprozess das Lageröl über den Sperrwasserabfluss der Kesselspeisepumpe in den Kondensator gelangen konnte. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um diesen Vorfall in der Zukunft zu vermeiden. Parallel galt es, eine schnelle und zuverlässige Lösung zur Reinigung des kontaminierten Kondensats (Menge ca. 485 m³) zu finden. Mithilfe der Fachkompetenz der Firma OptiOil gelang es, das verunreinigte Kondensat aufzubereiten.
Die Rolle der Kohle in einer ökologisch herausgeforderten Welt
Andrew Minchener
Kohle ist seit über 200 Jahren ein Eckpfeiler der industriellen Entwicklung, obwohl sie heute als Brennstoff der Vergangenheit gilt und im Globalen Norden im Rahmen der Bemühungen zur Begrenzung des Klimawandels schrittweise abgeschafft wird. Doch trotz mehr als 30 Jahren internationaler Klimaschutzmaßnahmen stieg die weltweite Kohleproduktion im Jahr 2024 auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Es besteht die Notwendigkeit, ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen mit der Realität des anhaltenden globalen Energieverbrauchs in Einklang zu bringen. In diesem Essay reflektiert Dr. Andrew Minchener OBE über 30 Jahre an der Spitze der Klimaschutzmaßnahmen im Bereich fossiler Brennstoffe und legt einige ehrliche Ansichten darüber dar, wie sich die nächsten 30 Jahre entwickeln könnten.
Nutzung von LNG zur Stromerzeugung, um den steigenden Strombedarf zu decken und die Energieversorgungssicherheit zu stärken
GEFC Gas Exporting Countries Forum
Review vgbe-Fachtagung „Gasturbinen und Gasturbinenbetrieb 2025“ – Zuverlässige Leistung in unsicheren Zeiten
vgbe energy
Der Schwerpunkt der diesjährigen vgbe-Fachtagung lag auf der Rolle von Gasturbinen im Kontext der Energiewende, insbesondere auf Fragen der Wasserstoffnutzung, Flexibilisierung, Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung. Die Fachtagung fand am 4. und 5. Juni 2025 statt und wurde von einer Fachausstellung begleitet.
Editorial
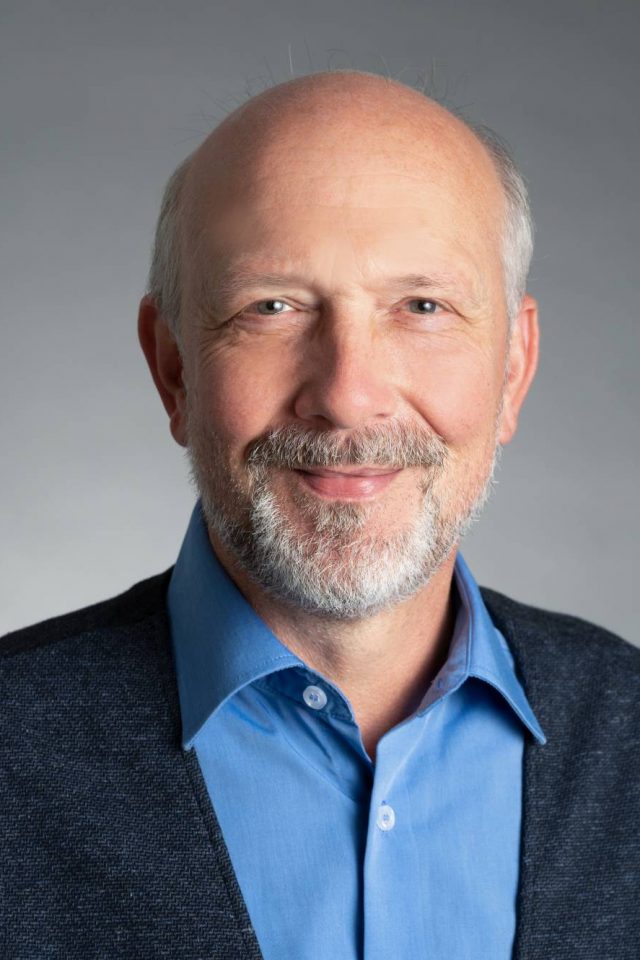
Christopher Weßelmann
Chefredakteur vgbe energy
KI und Stromerzeugung – Herausforderung für die Energiesysteme?
Liebe Leserinnen und Leser,
die Dynamik, mit der Künstliche Intelligenz – KI – in nahezu allen gesellschaftlichen und ökonomischen Bereichen Einzug hält, übertrifft derzeit die Geschwindigkeit vieler früherer technologischer Umwälzungen. Anwendungen reichen von der medizinischen Diagnostik über automatisierte Produktionsprozesse bis hin zu selbstlernenden Finanzsystemen oder der Steuerung hochkomplexer Lieferketten. Mit der rasanten Verbreitung von KI wächst jedoch auch eine neue Dimension des Energiebedarfs, die vor allem die Stromerzeugung unter erheblichen Druck setzt. Was bislang als schleichender Zuwachs erschien, nimmt durch die rapide Zunahme an Rechenzentren und die Entwicklung energieintensiver KI-Modelle eine Form an, die die Energiebranche nicht ignoriert.
Rechenzentren, die das Rückgrat der KI-Infrastruktur bilden, haben sich von klassischen Datenspeichern hin zu Hochleistungsclustern entwickelt, deren Stromverbrauch exponentiell steigt. Das Training und der Betrieb großskaliger neuronaler Netze benötigen mittlerweile elektrische Leistungen im dreistelligen Megawattbereich pro Standort. Parallel zur Leistungsaufnahme wächst auch die Anforderung an eine sichere, ausfallfreie und hochflexible Stromversorgung. Strombedarfe dieser Größenordnung entstehen nicht nur punktuell, sondern in Ballungsräumen, in denen der Wettbewerb um Netzkapazitäten ohnehin hoch ist. Damit verschärft sich ein Zielkonflikt zwischen traditioneller Versorgungssicherheit, dem notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien und dem steigenden Anspruch neuer, digital getriebener Industrien.
Besonders herausfordernd ist dabei der zeitliche Gleichlauf zwischen dem Ausbau von KI-Anwendungen und der Entwicklung von Erzeugungs- und Netzkapazitäten. Während neue Rechenzentren innerhalb weniger Monate realisiert werden können, benötigen Kraftwerke, Netze und Speicherlösungen oft Jahre bis Jahrzehnte für die Planung und Genehmigung. Diese Diskrepanz führt zu einer strukturellen Unterdeckung, die in vielen Regionen bereits spürbar ist. Erste Verzögerungen bei industriellen Investitionen in Nordamerika zeigen, dass die Strominfrastruktur zunehmend zum limitierenden Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung wird. Ähnliche Tendenzen sind in Asien erkennbar, wenngleich Länder wie China oder Südkorea durch den massiven Ausbau von Erzeugungskapazitäten und Netzen bislang schneller reagieren konnten.
Die Herausforderung besteht nicht nur im quantitativen Mehrbedarf, sondern auch in der qualitativen Natur der Nachfrage. KI-Rechenzentren benötigen eine Stromversorgung, die kontinuierlich, verlässlich und höchst stabil ist. Kurzfristige Schwankungen oder länger andauernde Dunkelflauten können durch die heutigen Backup-Systeme nur begrenzt abgefedert werden. Damit rückt das Thema gesicherte Leistung noch stärker in den Vordergrund.
Darüber hinaus eröffnet sich eine Diskussion über den globalen Wettbewerbsvorteil durch eine resiliente Energieinfrastruktur. Die Fähigkeit, KI in großem Maßstab einzusetzen, entwickelt sich zu einem entscheidenden Faktor für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften. Länder mit einer robusten Stromerzeugung und flexiblen Netzsystemen können die Potenziale von KI wesentlich schneller und umfassender nutzen. Regionen, die bei der Sicherung ihrer Energieversorgung zurückfallen, riskieren dagegen, auch im digitalen Wettbewerb ins Hintertreffen zu geraten. Damit verbindet sich Energiepolitik direkt mit Standortpolitik und der Fähigkeit, Wertschöpfung in der digitalen Ökonomie zu generieren.
Für die Energiebranche bedeutet dies, dass die Debatte über den Energiemix, die Rolle fossiler Brückentechnologien, den beschleunigten Netzausbau und die Notwendigkeit neuer Speicherlösungen mit neuer Dringlichkeit geführt werden muss. Der KI-Boom hat eine Dimension erreicht, in der die Energieversorgung nicht mehr allein im Kontext von Klimaneutralität und Dekarbonisierung, sondern auch als entscheidende Grundlage für die technologische Souveränität und wirtschaftliche Entwicklung betrachtet werden muss.
Das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Perspektiven – Versorgungssicherheit, Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und digitale Wettbewerbsfähigkeit – wird zur Kernaufgabe der kommenden Jahre. Nur wenn es gelingt, Stromerzeugung und Netze mit derselben Geschwindigkeit zu transformieren, mit der KI die globalen Märkte durchdringt, kann die Energiebranche den notwendigen Beitrag leisten. Andernfalls droht, dass der Mangel an verfügbarer und bezahlbarer Energie zum Flaschenhals einer Technologie wird, die das Potenzial hat, unser gesamtes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell neu zu gestalten.
